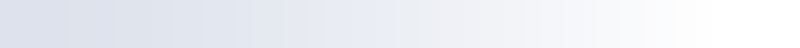Note: this content is only available in German.
Inhalt
- Editorial: EU-HTA-Verordnung: Erste Verfahren gestartet – ein weiterer Meilenstein für HTA in Österreich
- Framework für Managed Entry Agreements bei kostenintensiven, einmaligen Therapien mit kurativem Potenzial
- Bevölkerungsgesundheitseffekte von NICE empfohlener Arzneimittel in England
- Quantifizierung von Low-Value Care in Deutschland
- Framework für die Anwendung von Kosteneffektivitätsanalysen zur Unterstützung von Preis- und Erstattungsentscheidungen für neue Arzneimittel in dynamischen Gesundheitsmärkten
- Termine (+Umfrage)
- Themen-Vorschau