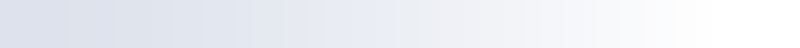Note: this content is only available in German.
Inhalt
- Editorial: Abschied nach 36 Jahren Health Technology Assessment
- Exa-cel, Casgevy® bei Sichelzellkrankheit und Beta-Thalassämie
- Kontrollmechanismen in DRG-basierten Krankenhausfinanzierungssystemen
- Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen in der ADHS-Diagnostik
- Computergestützte Entscheidungsunterstützungssysteme für Pflegekräfte und Rettungsfachpersonal
- Termine
- Themen-Vorschau