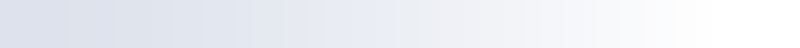Note: this content is only available in German.
Inhalt
- EUPATI: Patienteninformation aus Pharmahand
- Magnetischer Speiseröhren Ring bei gastroösophagealer Refluxkrankheit
- Zungenschrittmacher bei Schlafapnoe
- Einzeitiger matrix-assistierter Knorpelersatz bei chondralen Defekten im Knie
- Medikamentenbeschichtete Ballonkatheter in 4 Indikationen
- Radiofrequenzdenervierung bei Schmerzen im Bereich der Iliosakral- und Facettengelenke
- Sondenlose Herzschrittmacher bei kardialen Arrhythmien
- Klinischer Nutzen neuer Onkologika und Refundierungspolitiken
- Termine
- Themen-Vorschau