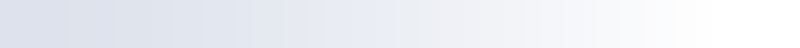Note: this content is only available in German.
Inhalt
- Editorial: „Value-Based Healthcare“: Kritik an enger Definition und Strategien für echte werte-basierte Umverteilung
- Digital Health: Leitfäden und Richtlinien für die einheitliche Bewertung digitaler Gesundheitstechnologien
- Suizidale Krisen bei Depressionen: Wirksamkeit nicht-medikamentöser Maßnahmen
- „Task-Shifting“: Die Verlagerung von ärztlichen Tätigkeiten. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Gesundheitswesen
- Reduktion an Notfallambulanzaufnahmen chronisch kranker Personen durch peergestützte Selbstmanagementprogramme
- Termine
- Themen-Vorschau