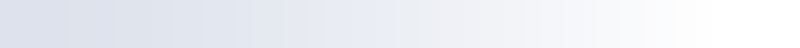Note: this content is only available in German.
Inhalt
- Editorial: „Des Kaisers neue Kleider“ - die Demenzforschung in der Krise
- Nutzenbewertung von KI-Gesundheitstechnologien
- Sektorübergreifende Versorgungsmodelle: Onkologische Brustkrebsversorgung in ausgewählten europäischen Ländern
- Strategien zur Reduzierung von Gewichtsdiskriminierung im Gesundheitswesen
- Screening auf psychische Erkrankungen bei Erwachsenen in der Primärversorgung
- Termine
- Themen-Vorschau