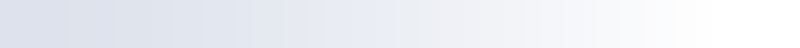Note: this content is only available in German.
Inhalt
- 10 Jahre LBI-HTA: wir feiern Geburtstag!
- Gesellschaftliches Engagement zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten
- „Umschriebene Entwicklungsstörung“ motorischer Funktionen: Screening, Diagnostik und Therapieindikation
- Ganzkörperkältetherapie (GKK): bei muskuloskeletalen Erkrankungen, Osteoarthritis, rheumatoider Arthritis, atopischer Dermatitis und Depression
- Multiples Myelom: Kosteneffektivität von 6 neuen Behandlungsregimen
- Termine
- Themen-Vorschau