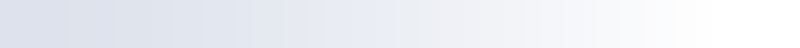Note: this content is only available in German.
Inhalt
- Editorial: Unterversorgung und evidenzbasierte Medizin - Ein Weckruf aus Deutschland
- NL: Bürgerbefragung zu sozialverträglichen Arzneimittelpreisen
- Rapid Review: Telerehabilitation bei chronischen Rückenschmerzen
- Rapid Review: Serumaugentropfen bei schweren Augenerkrankungen
- D: Gemeinsamer Bundesausschuss gibt grünes Licht für Liposuktion
- UK: NICE publiziert neuen Qualitätsstandard „Overweight and obesity management“
- Zweifel an Ticagrelor: Methodische Mängel in wichtigen Studien zu Blockbuster-Medikament identifiziert
- Termine