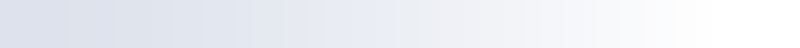Note: this content is only available in German.
Inhalt
- EC-ExpertInnen-Panel legt Bericht zu hochpreisigen, aber oft wenig innovativen Medikamenten vor
- Bewertungsinstrumente für Palliativbetreuung
- Weiterbildungsbedarf bei GesundheitspflegeassistentInnen in Krankenhäusern
- Amalgam vs. Komposit-Kunststoffe bei Zahnkavität
- Evolocumab bei Familiärer Hypercholesterinämie: Update zu Wirksamkeit und Kosteneffektivität
- Termine
- Themen-Vorschau