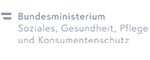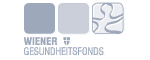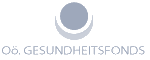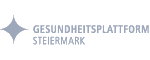Bildgesteuerte Infiltrationen bei der Behandlung chronischer Wirbelsäulenschmerzen: ein Überblick über evidenzbasierte Leitlinienempfehlungen unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Bildgebungsmöglichkeiten

Projektleitung: Gregor Goetz
Projektbearbeitung: Mirjana Huic (first author, HTA/EBM Center, Croatia), Gregor Götz (second author, AIHTA, Austria)
Laufzeit: April 2023 – Oktober 2023
Sprache: Englisch (mit deutscher Zusammenfassung)
Publikation: HTA Project Report Nr. 156: https://eprints.aihta.at/1477/
Hintergrund: Chronische Wirbelsäulenschmerzen sind weltweit die am weitesten verbreitete chronische Erkrankung: Am häufigsten treten die Schmerzen im unteren Rückenbereich (43 %), in der Nackenwirbelsäule (32 %) und der Brustwirbelsäule (13 %) auf. Häufige Gründe für chronische Wirbelsäulenschmerzen sind Pathologien innerhalb der Bandscheiben, Facettengelenke, Iliosakralgelenke, Bänder, Faszien, und Muskeln [1]. Bei der österreichischen Gesundheitsbefragung 2019 gaben 1,9 Mio. Menschen an, in den letzten zwölf Monaten von chronischem Kreuzschmerz oder einem anderen chronischen Rückenleiden betroffen gewesen zu sein. Frauen leiden dabei etwas häufiger an chronischem Kreuzschmerz als Männer (27,3 % im Vergleich zu 24,5 %). Der chronische Kreuzschmerz liegt nach Allergien an zweiter Stelle der am häufigsten genannten chronischen Erkrankungen bei unter 45-Jährigen. In der Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen wird er sogar häufiger als jede andere chronische Erkrankung angegeben. Auch in der Gruppe der über 60-Jährigen wurde der chronische Kreuzschmerz nur noch von Bluthochdruck übertroffen. Von chronischen Nackenschmerzen waren 19,5 % der Bevölkerung betroffen, Frauen ebenfalls öfter als Männer (24,8 % bzw. 14,0 %). Bei der österreichischen Gesundheitsbefragung wurden im Zeitraum von Oktober 2018 bis September 2019 der Gesundheitszustand von 15, 461 Personen erhoben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren [2].
Für die Betroffenen von Rückenschmerzen entsteht eine hohe Belastung durch den chronischen Schmerzzustand und die Funktionsbeeinträchtigungen. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität, Arbeitsunfähigkeit sowie psychischen und sozialen Folgen führen [3]. Jahrelange Fehlhaltung und Abnutzung haben oft einen Bandscheibenschaden zur Folge, welcher nicht unmittelbar mit Schmerzen einhergeht. Die typischen einschießenden Schmerzen können aber jederzeit durch eine ruckartige Verdrehung der Wirbelsäule oder eine ungeschickte Bewegung ausgelöst werden. Je nach Grad der Schädigung werden drei Formen des Bandscheibenschadens unterschieden; die Bandscheibenvorwölbung (Protrusion), der Bandscheibenvorfall (Prolaps) und ein sequestrierter Bandscheibenvorfall (Bandscheibengewebe tritt in den Wirbelkanal). Kommt es durch den Bandscheibenschaden zu einer Nervenreizung, durch Irritation oder Kompression, führt dies zu mehr oder weniger starken Schmerzen, die als Radikulopathie oder Wurzelreizsyndrom bezeichnet werden [3]. Die Spinalkanalstenose (Verengung des Wirbelkanals) ist meist bedingt durch degenerative Veränderungen und kann ebenfalls zu dieser radikulären Symptomatik führen [3].
Für die Behandlung von Rückenschmerzen existieren zahlreiche Leitlinien, die Behandlungsalgorithmen darstellen [1, 4, 5]. Wenn konservative Maßnahmen Schmerzen nicht wirksam lindern, kommen u.a. Infiltrationen eines Gemisches aus Kortikosteroiden und Lokalanästethikum in den Epiduralraum/periradikulär (Zugang transforaminal, kaudal und interlaminär) unter Bildsteuerung zum Einsatz. Dafür werden international unterschiedliche bildgebende Technologien eingesetzt. Im deutschsprachigen Raum scheint vorwiegend die CT-gezielte Infiltration verwendet zu werden, in anderen Ländern dominieren andere Verfahren (z.B. Fluoroskopie). [6]. Häufig sind die Präferenzen in Bezug auf die Ausbildungserfahrung, die Verfügbarkeit von Ressourcen sowie die institutionelle Politik ausschlaggebend für die Entscheidung, welche Bildgebungsmöglichkeit verwendet wird [7]. Aus der Sicht von Entscheidungsträgern ist es unklar, ob bildgesteuerte Infiltrationen in Österreich immer angemessen zum Einsatz kommen.
Projektziel und Forschungsfragen: Das Ziel dieses Projektes ist es, die Einsatzgebiete der bildgesteuerten rückenmarksnahen Infiltration anhand von klinischen Leitlinien zu identifizieren, sowie eine Synopse der evidenzbasierten Empfehlungen zu den jeweiligen Indikationen durchzuführen. Zudem soll überprüft werden, welche Rolle der CT-gezielten Infiltration in Bezug auf die unterschiedlichen Arten der Bildgebung zugeschrieben wird. Der Bericht wird auch auf mögliche organisatorische und soziale Aspekte eingehen, um für Entscheidungen relevante Kontextfaktoren zu berücksichtigen. Folgende Forschungsfragen (FF) sollen dabei beantwortet werden.
- FF1: Welche Empfehlungen für oder gegen die Anwendung einer Infiltration (Gemisch aus Glukokortikoid-Lokalanästhetikum) unter Bildgebung bieten evidenzbasierte Leitlinien bei spezifischen Indikationen im Bereich der Wirbelsäulenerkrankungen?
- FF2: Welche Rolle wird in Bezug auf die unterschiedlichen Bildgebungen der CT-gezielten Infiltration zugeschrieben?
- FF3: Welche organisatorischen und sozialen Aspekte könnten bei der Anwendung und Umsetzung von bildgesteuerten Infiltrationen (mit Lokalanästhetika und Steroiden) zur Behandlung von chronischen Wirbelsäulenschmerzen zu berücksichtigen sein?
Einschlusskriterien für die Leitliniensynopse und andere Aspekte
|
Population |
Patient*innen mit chronischen Wirbelsäulenschmerzen (z. B. im Zusammenhang mit Bandscheibenvorfällen, Spinalkanalstenose, axialen diskogenen Schmerzen und bei postoperativem Syndrom) Wirbelsäulenbereiche: zervikal, thorakal, lumbal, sakral |
|
Intervention |
Infiltration eines Gemisches aus Kortikosteroiden und Lokalanästethikum in den Epiduralraum/periradikulär (Zugang transforaminal, kaudal und interlaminär) unter Bildsteuerung (z.B. CT, Fluoroskopie) mit besonderem Fokus auf CT-gezielte Infiltrationen |
|
Control |
- |
|
Outcome (Ergebnisparameter) |
Evidenzbasierte Leitlinienempfehlungen: Indikationen und Anwendungsgebiete, Level of Evidence (LoE) und Grade of Recommendation (GoR) Organisatorische (ORG) und Soziale (SOZ) Aspekte (gemäß dem EUnetHTA Core HTA Model® 3.0) [8]:
|
|
Setting |
Länder des globalen Nordens |
|
Study Design |
Evidenzbasierte Leitlinien, systematische Übersichtsarbeiten (für ORG und SOZ) |
|
Publikationszeitraum |
Ab 2018 |
|
Sprache |
Englisch, Deutsch |
Methoden: Suche nach relevanten Empfehlungen in evidenzbasierten Leitlinien:
- Es wird zunächst eine systematische Literatursuche in mehreren Datenbanken (MEDLINE via Ovid, Embase, Centre for Research and Dissemination (CRD), Cochrane (CENTRAL) durchgeführt.
- Eine gezielte Handsuche in der GIN-Datenbank ergänzt die systematische Suche
Auswahl, Bewertung und Synopse der identifizierten Leitlinien(-empfehlungen):
- Leitlinienauswahl durch 2 Wissenschaftler*innen
- Qualitätsbewertung [9]mittels AGREE-II (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) durch eine Person, Kontrolle durch zweite Person
- Extraktion der Empfehlungen zur Anwendung in Bezug auf Infiltration unter Bildsteuerung (neben generellen Empfehlungen werden explizit auch jegliche Aussagen zu der CT-gezielten Infiltration extrahiert)
- Qualitative Synthese und Gegenüberstellung der Empfehlungen
Andere Domäne (organisatorische und soziale Aspekte): Die Auswahl der Themengebiete für potenzielle organisatorische und soziale Aspekte erfolgt auf der Grundlage des EUnetHTA Core Model® Version 3.0 [8]:
- Informationsquellen: klinische Leitlinien und SR (Identifikation: siehe oben).
- Synthese: Informationen aus den verschiedenen untersuchten Quellen werden deskriptiv beschrieben.
Zeitplan/ Meilensteine
Zeitplan: April bis Oktober 2023 (3 PM)
|
Periode |
Leistungen |
|
April/Mai 2023 |
Scoping, systematische Literatursuche und gezielte Handsuche nach evidenzbasierten Leitlinien und systematischen Übersichtsarbeiten |
|
Juni/Juli 2023 |
Auswahl und Beschaffung der Leitlinien, Beurteilung mit AGREE-II, Datenextraktion |
|
August 2023 |
Verschriftlichung |
|
September 2023 |
Interner und externer Review |
|
Oktober 2023 |
Fertigstellung des Berichts, Layout und Veröffentlichung des Berichts |
Literatur
[1] L. Manchikanti, N. N. Knezevic, A. Navani, P. J. Christo, G. Limerick, A. K. Calodney, et al. Epidural Interventions in the Management of Chronic Spinal Pain: American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Comprehensive Evidence-Based Guidelines. Pain Physician. 2021;24(S1):S27-s208.
[2] S. Austria. Österreichische Gesundheitsbefragung 2019. Hauptergebnisse des Austrian Health Interview Survey (ATHIS) und methodische Dokumentation 2020. Available from: https://www.statistik.at/suche?tx_solr%5Bq%5D=gesundheitsbefragung+2019.
[3] Gesundheitsportal. Rückenschmerzen. 2021. Available from: https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/koerper/wirbelsaeule/bandscheibenvorfall.html.
[4] L. Manchikanti, E. Knezevic, R. E. Latchaw, N. N. Knezevic, S. Abdi, M. R. Sanapati, et al. Comparative Systematic Review and Meta-Analysis of Cochrane Review of Epidural Injections for Lumbar Radiculopathy or Sciatica. Pain Physician. 2022;25(7):E889-e916.
[5] D. Sayed, J. Grider, N. Strand, J. M. Hagedorn, S. Falowski, C. M. Lam, et al. The American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) Evidence-Based Clinical Guideline of Interventional Treatments for Low Back Pain. J Pain Res. 2022;15:3729-3832. Epub 20221206. DOI: 10.2147/jpr.S386879.
[6] AWMF. Leitlinie zur konservativen, operativen und rehabilitativen Versorgung bei Bandscheibenvorfällen mit radikulärer Symptomatik. 2021. Available from: https://register.awmf.org/de/start.
[7] W. E. Palmer. Spinal Injections for Pain Management. Radiology. 2016;281(3):669-688. DOI: 10.1148/radiol.2016152055.
[8] European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA). HTA Core Model. Version 3.0. 2016. Available from: https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/03/HTACoreModel3.0-1.pdf.
[9] M. C. Brouwers, K. Kerkvliet and K. Spithoff. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines. Bmj. 2016;352:i1152. Epub 20160308. DOI: 10.1136/bmj.i1152.