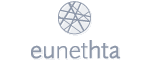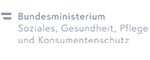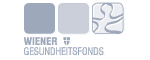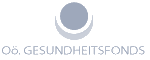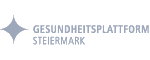- Aktuelles
- Newsletter
- Newsletter September 2024 | Nr. 230
- Editorial: Korruptionsforschung als aktiver Beitrag zum Handeln gegen Korruption
Editorial: Korruptionsforschung als aktiver Beitrag zum Handeln gegen Korruption
Der Gesundheitssektor ist aufgrund seiner Komplexität, bedingt durch Entscheidungen unter Unsicherheit, asymmetrische Informationen und eine Vielzahl an Akteuren mit unterschiedlichen Interessen, besonders anfällig für Korruption. Verschiedene Typologien versuchen diese Komplexität zu erfassen, um wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Die Europäische Union unterscheidet etwa zwischen Korruption bei medizinischen Dienstleistungen, Beschaffungsprozessen und Marketingaktivitäten, Machtmissbrauch, unberechtigten Erstattungsforderungen und Betrug inklusive Unterschlagung von Geldern. Der Korruptionsforscher Thompson erweitert diese Typologie um institutionelle Korruption, welche Verhaltensweisen beschreibt, die – bedingt durch systemische Mängel in Institutionen – die Integrität und Ziele des Gesundheitssystems korrumpieren.
Institutionelle Korruption ist besonders im Kontext der pharmazeutischen Industrie umfassend dokumentiert. Sie äußert sich etwa in der Schaffung finanzieller Interessenkonflikte seitens der Pharmaindustrie durch die finanzielle Unterstützung medizinischer Fachgesellschaften, die Finanzierung von ärztlichen Weiterbildungsmaßnahmen oder die Entlohnung von Ärzt*innen für die Teilnahme an Marketingstudien. Auch deren gezielte Einflussnahme auf den gesamten Forschungsprozess, von der Planung klinischer Studien bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse und die Beeinflussung der Meinungsbildung in der klinischen Praxis durch die systematische „Akquise“ angesehener Wissenschaftler*innen, sogenannter Key Opinion Leaders, mittels Honoraren und In-Aussicht-Stellen von Publikationen werden als institutionell korrupt erachtet, wie eine rezente Literaturübersicht (3) anhand zahlloser Beispiele zeigt.
Die Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen erfordert einen vielschichtigen Ansatz. Die notwendige Sensibilisierung der Bevölkerung sollte durch einen Mix aus rechtlichen, wirtschaftlichen und institutionellen Reformen ergänzt werden. Dabei ist neben der Implementierung geeigneter Maßnahmen auch deren konsequente Umsetzung sowie laufende und rasche Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen wichtig, wie die SARS-CoV-2-Pandemie gezeigt hat. Auch ein stärkerer Fokus auf Transparenz und Rechenschaftspflicht ist im Kampf gegen Korruption entscheidend. Strategien zur Korruptionsbekämpfung müssen individuelles und institutionelles Fehlverhalten adressieren. Es reicht nicht aus, sich nur auf einzelne korrupte Personen zu konzentrieren. Vielmehr müssen auch die institutionellen Rahmenbedingungen angepasst werden, die korruptes Verhalten begünstigen. Nachhaltiges Engagement von Regierungen, Entscheidungsträgern und internationalen Organisationen bei der Entwicklung und Pflege effektiver nationaler und globaler Anti-Korruptionsstrategien ist dabei unerlässlich.
Das EU-Papier (1) bringt zahlreiche Politikoptionen in drei Bereichen (Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Durchsetzung der bestehenden Gesetze und Mandatserweiterung der Hauptakteure sowie Förderung von Qualität und Kontrolle des öffentlichen Beschaffungswesens) zur Bekämpfung von Korruption zum Vorschlag.
ao. Univ.-Prof. Dr. Margit Sommersguter-Reichmann
Institut für Finanzwirtschaft, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Referenzen:
- European Parliamentary Research Service (EPRS). 2023. Stepping up the EU's efforts to tackle corruption. Cost of Non-Europe Report. EPRS_STU(2023)734687_EN.pdf (europa.eu)
- United Nations (UN). 2024. Ziele für nachhaltige Entwicklung. https://unric.org/de/17ziele/.
- Sommersguter-Reichmann, M., Reichmann, G. Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. Health Econ Rev 14, 50 (2024). https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6