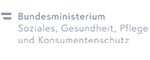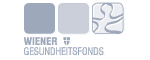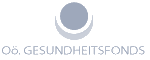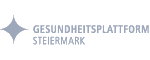Eltern-Kind Vorsorge neu

Projektbearbeitung: Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-Koss
Marisa Warmuth, Philipp Mad, Ines Schumacher
Laufzeit: April 2010 - März 2011
Weitere Projektbeteiligte: Stefan Mathis, Tarquin Mittermayr, Imke Schall, Tina Loibl
Initiator/Auftraggeber: Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Sprache: Deutsch
Publikationen: Eltern-Kind-Vorsorge neu.
Teil I: Epidemiologie – Häufigkeiten von Risikofaktoren und Erkrankungen in Schwangerschaft und früher Kindheit.
HTA-Projektbericht 045a
Teil II: Internationale Policies, Konzepte und Screeningstrategien zu „Normal-“ und „Risikoverläufen“ während der Schwangerschaft und frühen Kindheit bis zum Schuleintritt.
HTA-Projektbericht 045b
Teil III: Ist-Erhebung der Finanzierungs- und Kostenstrukturen von Eltern-Kind Leistungen in Österreich.
HTA-Projektbericht 045c
Teil IV: Synthese der Teile I-III, Handlungsempfehlungen.
HTA-Projektbericht 045d
Hintergrund
Das Mutter-Kind-Pass (MKP) Untersuchungsprogramm wurde in Österreich erstmals 1974 eingeführt. Seitdem wurden zwar das Untersuchungsspektrum stetig erweitert und die Anzahl der Untersuchungen schrittweise erhöht, eine systematische Evaluierung des Untersuchungsprogramms wurde jedoch nie durchgeführt, so auch nicht der sich eventuell verändernde Bedarf. Eine Evaluierung des österreichischen MKP sollte primär die Analyse des spezifischen Bedarfs einer zielgruppen-orientierten notwendigen „Breite“ und „Tiefe“ der angebotenen und ev. neuer/ anderer Leistungen umfassen als auch sekundär die Evidenzbasierung der bestehenden Leistungen hinterfragen.
Das österreichische MKP Untersuchungsprogramm ist ein klassisches (epidemiologisches) Screeningprogramm an Gesunden, bei dem die WHO-Kriterien zu Screenings zur Anwendung kommen müssen. Derzeit umfasst der MKP Untersuchungen sowohl der werdenden Mutter ab Feststellung einer bestehenden Schwangerschaft bis zur Geburt, als auch des Kindes von der Geburt bis zum einschließlich 62. Lebensmonat. Der in der heutigen Form existierende MKP ist vorwiegend „medizin-zentriert“ und schließt die Diagnostik/ Versorgung durch andere Berufsgruppen als MedizinerInnen, wie Hebammen, Krankenschwestern/ -pflegern, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen etc., weitgehend aus. Jüngere nationale und internationale Modellprojekte stellen aber stärker Risikogruppen ins Zentrum der MK-Versorgung.
Die MKP Leistungen werden großteils öffentlich über mehrere Kostenträger finanziert. Flankierend dazu wurde mit im Zeitverlauf unterschiedlichen und oftmals mit Familienleistungen gekoppelten monetären Anreizsystemen versucht, eine möglichst hohe Teilnahme bei der Vorsorge zu erreichen. Für die Entwicklung eines am heutigen Bedarf der Zielgruppen orientierten Konzepts ist neben der Definition des Bedarfs an Leistungen und Organisationsstrukturen auch ein entsprechendes Finanzierungskonzept notwendig.
Ziel des Gesamtprojektes
Das Ziel ist, eine Entscheidungsunterstützung für eine Neuorientierung in der Eltern-Kind Vorsorge in Österreich zu erarbeiten, um es EntscheidungsträgerInnen zu erleichtern, die Vorsorge dem tatsächlichen (heutigen) Bedarf anzupassen.
Ziele der Teilprojekte
Teil 1: Epidemiologie und Erhebung von Risikofaktoren wie Erkrankungen
Ziel: Eine Zusammenführung und Analyse epidemiologischer Daten zu bestehenden Risikofaktoren und Erkrankungen in den definierten Zielgruppen soll das Spektrum von Risikofaktoren und Erkrankungen und deren Häufigkeiten aufzeigen und die Grundlage für eine Bedarfsfeststellung von Leistungen bilden.
Teil 2: Internationale Praktiken und „Models of Good Practice” von MK Vorsorge
Ziel: Eine Vergleichsanalyse soll gängige Praktiken mit ähnlichen Screening-Instrumenten, aber auch Erfahrungen aus internationalen Modellen zu vertiefender Risikogruppen Versorgung sowie andere innovative Leistungsaspekte zusammenführen.
Teil 3: Ökonomische Analyse
Ziel: Die Darstellung der Finanzierungs- und Anreizstrukturen (Kostenträger, Finanzierungsströme, LeistungsempfängerInnen) und der Kosten/Ausgabenstrukturen der derzeitigen Mutter-Kind-Vorsorge (Mutter-Kind-Pass, sowie weiterer Vorsorgemaßnahmen für Schwangere, Neugeborene und Kleinkinder) soll den derzeitigen IST-Stand abbilden.
Teil 4: Synthese der Teile 1-3, Handlungsempfehlungen
Ziel: basierend auf den Teilen 1-3 soll der konkrete Bedarf nach Versorgungsleistungen abgeleitet und benannt werden.
Forschungsfragen und Untersuchungsmethoden
Teil 1: Epidemiologie und Erhebung von Risikofaktoren wie Erkrankungen
Welche Risikofaktoren/ Erkrankungen treten in der jeweiligen Zielgruppe auf und wie häufig sind diese?Welche Risikofaktoren treten in der jeweiligen Zielgruppe auf der Ebene des Individuums (Alter, Geschlecht, Genetik, Lebensstilfaktoren) sowie der Umwelt (soziale Netzwerke, Arbeits- und Lebensbedingungen, sozioökonomische, kulturelle, Umweltfaktoren) auf? Wie häufig sind diese und in welcher Ausprägung treten diese Risikofaktoren auf? Bestehen Unterschiede bezüglich Risikofaktoren/ Erkrankungen in der jeweiligen Zielgruppe in Abhängigkeit soziodemografischer Merkmale, wie Alter, Bildungsgrad, sozioökonomischem Status, ethnischem Hintergrund etc.?
Inhalt
| Schwangerschaft |
Risikofaktoren und Erkrankungen der Mutter |
Risikofaktoren und Erkrankungen des ungeborenen Kindes |
| Geburt |
Risikofaktoren und Erkrankungen der Mutter |
Risikofaktoren und Erkrankungen des Neugeborenen |
|
Säuglings- und Kleinkindalter und frühe Kindheit |
Risikofaktoren und Erkrankungen des Säuglings- und Kleinkindalters und der frühen Kindheit |
|
| Konkomitante Faktoren | Lebensstilfaktoren und psychosoziale Faktoren |
Methoden
- Systematische Literaturrecherche in folgenden Datenbanken: CRD-INAHTA, Embase, Ovid Medline, PsycINFO, PSYNDEX, The Cochrane Library, Web of Science und MedPilot
- (Un)systematische Literatursuche in Datenbanken, ausgewählten medizinischen Fachzeitschriften, Fachgesellschaften, HTA-Instituten
- Synthese statistischer Daten aus Österreich (Statistik Austria, Geburtenregister, Gesundheitsberichte bzgl. Erkrankungen/ Risikofaktoren/ Risikoverhalten
- Vergleich der erhobenen statistischen Daten mit dem derzeitigen Mutter-Kind Pass bzgl. Untersuchungen, fehlender Untersuchungen, fehlender Daten
- Workshop mit nationalen ExpertInnen
Teil 2: Internationale Praktiken und „Models of Good Practice” von MK Vorsorge
Welche medizinischen und psychosozialen Parameter werden im Rahmen der Mutter-Kind Untersuchungen zu welchen Untersuchungszeitpunkten erhoben?Welche LeistungserbringerInnen (Berufsgruppen z.B. der Fachbereiche Medizin, Geburtsvorbereitung, Psychologie, Sozialarbeit, Familienberatung etc.) sind im Rahmen der Untersuchungen involviert?Welche länderspezifischen Besonderheiten bzgl. der Leistungsbreite (Serviceumfang) und der Leistungstiefe (Differenzierung nach bestimmten Zielgruppen wie etwa Frauen mit Risikoschwangerschaften, Schwangere/Mütter, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind etc.) gibt es?
Methoden
- Internet Recherche nach Informationen öffentlicher Institutionen,
- (un)systematische Literatursuche in Datenbanken,
- Fragebogenerhebung
- Vergleichende Gegenüberstellung der Screening-Instrumente und Leistungen
- Workshop mit nationalen ExpertInnen
Teil 3: Ökonomische Analyse
Was sind die Finanzierungsstrukturen (Kostenträger, Finanzierungsströme, Leistungs-empfängerInnen) der derzeitigen Mutter-Kind Vorsorge, auf welcher gesetzlicher Grundlage beruhen sie und wie sind sie in das Gesamtfinanzierungssystem im Gesundheits- und Sozialbereich eingebettet?Welchen Anreizsysteme und damit verbundene Anreizwirkungen (insb. Teilnahmerate) gehen/gingen mit den bisherigen Finanzierungsstrukturen einher? Gibt es hierzu ergänzend internationale best practice Beispiele?Was sind die Finanzierungsstrukturen (Kostenträger, Finanzierungsströme, LeistungsempfängerInnen) von Vorsorgemaßnahmen, die in Form von Sach- oder Geldleistungen für Schwangere, Neugeborene und Kleinkinder, „außerhalb“ des Mutter-Kind-Passes angeboten werden?Wie hoch sind die Kosten für einzelne Leistungen und die öffentlichen (und privaten) Gesamtausgaben im Zeitverlauf?
Methoden
- Recherche österreichischer Dokumente zu Finanzierungsstrukturen und gesetzlichen Grundlagen
- Befragung von RepräsentantInnen der Kostenträger
- Kostenanalyse auf Basis von Sozialversicherungsabrechnungsdaten, Krankenhausdaten, Sekundärliteratur
Teil 4: Synthese der Teile 1-3, Handlungsempfehlungen
Welche der aufgezeigten Gesundheitsbedrohungen werden durch Leistungen des derzeitigen Mutter-Kind-Passes adäquat identifiziert?Werden diese auch in der Routine Vorsorge (bzw. der Vorsorge „policy“) international berücksichtigt? Welche anderen, relevant erscheinenden Gesundheitsbedrohungen werden für welche Zielgruppe international alternativ/ zusätzlich in einer Eltern-Kind-Vorsorge berücksichtigt?Gibt es Erfahrungen, wie diese Gesundheitsbedrohungen identifiziert werden und welche Konsequenzen eine gezielte Risikogruppenvorsorge hat? Welche Rolle nimmt dabei die Finanzierung einzelner Leistungen (derzeit im Mutter-Kind-Pass enthalten/ nicht enthalten) ein?
Methoden
- Synthese der in den Teilen 1-3 gewonnenen Erkenntnissen
- Gegenüberstellung der Inhalte/ Finanzierung des derzeitigen Mutter-Kind-Passes mit identifizierten Gesundheitsbedrohungen bzw. internationalen Vorgehensweisen