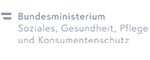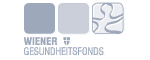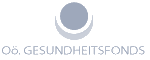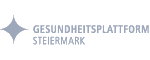Evidenzbasierte Erstattungsprozesse in Europa Teil 2: Eine vergleichende Analyse ausgewählter Medizinprodukte in deutschen, englischen, französischen und österreichischen Krankenhäusern und möglicher Einflussfaktoren

Projektleitung: Helene Eckhardt*, Gregor Goetz*
Projektbearbeitung: Helene Eckhardt*, Gregor Goetz*, Hendrikje Lantzsch, Cornelia Henschke, Dimitra Panteli
Laufzeit: Oktober 2020 – August 2021
Sprache: Englisch
*geteilte ErstautorInnenschaft
Wie wichtig sind Evidenz und unterschiedliche strukturelle Faktoren für die Nutzung neuer Medizinprodukte mit unsicherem klinischen Nutzen in Deutschland, Österreich, Frankreich und England? Eine vergleichende Analyse der Nutzung von Medizinprodukten in Krankenhäusern und möglicher Einflussfaktoren (2005 und 2017).
Hintergrund: Medizinische Verfahren, bei denen Medizinprodukte zum Einsatz kommen, sind in der Europäischen Union (EU) vergleichsweise weniger reguliert als Arzneimittel. Es gibt einige historische Beispiele, wie die Regulierung dieser (insbesondere in Bezug auf den erforderlichen Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit) zu erhöhten Risiken für Patient*innen führen kann [1, 2]. Die Zulassung (CE-Kennzeichnung) von Medizinprodukten in Europa erfolgt bereits in einem frühen Stadium der Evidenzentwicklung [3]. Es gibt jedoch bereits Ansätze, die Regulierung auch im Hinblick auf die Rolle der klinischen Evidenz zu stärken [4]. Dazu zählt die neue EU-Verordnung über Medizinprodukte (EU-MDR 2017/745) [5].
Nach der Zulassung eines Medizinprodukts in der EU wird über die Erstattung auf nationaler oder regionaler Ebene entschieden. Der Erstattungsprozess von Medizinprodukten in der Krankenhausversorgung in Österreich, Frankreich und England wird durch wissenschaftliche Nutzenbewertungen unterstützt, die vom Österreichischen Institut für HTA (AIHTA), der Haute Authorité de Santé (HAS) bzw. dem National Institute for Health Excellence (NICE) durchgeführt werden [6-10]. Konträr dazu können in deutschen Krankenhäusern jede CE-gekennzeichnete Technologie in der stationären Versorgung eingesetzt werden, außer derjenigen, die der Gemeinsame Bundesausschuss explizit ausschließt [11].
Eine rezente Analyse untersuchte den Einsatz der Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) zwischen 2009 und 2016 im österreichischen Gesundheitssystem. Es zeigte sich ein konstanter Anstieg der TAVI und einen leichten Rückgang ihres Komparators, nämlich des chirurgischen Aortenklappenersatzes [12].
Diese Studie baut auf einer anderen derzeit laufenden Studie der Technischen Universität Berlin (TUB) auf, die den Zusammenhang zwischen Fallzahlen von 27 neuen Medizinprodukten in der stationären Versorgung in Deutschland und der Entwicklung der wissenschaftlichen Evidenz zwischen 2005 und 2017 systematisch untersucht. Um die Evidenz zur Wirksamkeit und Sicherheit zu überprüfen, wurden systematische Literaturrecherchen in vier Datenbanken durchgeführt. Zusätzlich wurden klinische Studienregister, Health Technology Assessment (HTA)-Datenbanken, verschiedene Quellen von klinischen Leitlinien, Vergütungsdokumentationen und Monitoringsysteme zur Überwachung von unerwünschten Ereignissen durchsucht. In die Analyse wurden Publikationen der Evidenzstufen I-IV (gemäß Definition des G-BA) einbezogen, die zwischen 2003 und 2017 veröffentlicht wurden. Die Fallzahldaten wurden aus den stationären Abrechnungsdaten, aggregiert über alle deutschen Krankenhäuser für die einzelnen Jahre 2005-2017, berechnet. Die Publikationen wurden nach ihrer jeweiligen Evidenzstufe I-IV über die Zeit auf einer Ordinate und die Anzahl der Fälle auf derselben Zeitachse geplottet.
Für die vergleichende Analyse wurden folgende Verfahren ausgewählt: bioresorbierbare medikamentenbeschichtete Stents (BRS), mechanische Thrombektomie und TAVI.
Ziele des Projekts und Forschungsfragen: Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Entwicklung der Inanspruchnahme im Zusammenhang mit der publizierten Evidenz, dem Erstattungsprozess und anderen strukturellen Faktoren wie Finanzierung, Sicherheitswarnungen und Empfehlungen klinischer Leitlinien zwischen Deutschland, England, Frankreich und Österreich zu vergleichen, um 1) den Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme neuer Medizinprodukte mit ungewissem klinischen Nutzen und den oben genannten Unterschieden zwischen den Ländern zu verstehen und 2) „Lehren“ für die untersuchten Gesundheitssysteme zu ziehen.
Ausgehend von den Zielen unserer Forschung haben wir die folgenden Forschungsfragen (FF) definiert:
· FF1: Wie unterscheidet sich der Erstattungsprozess von neuen Medizinprodukten zwischen Deutschland, England, Frankreich und Österreich?
· FF2: Wie verhält sich die Nutzung neuer Medizinprodukte zu verfügbarer wissenschaftlicher Evidenz, Finanzierung, Sicherheitswarnungen und Empfehlungen in Deutschland, England, Frankreich und Österreich im Zeitverlauf? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Gesundheitssystemen sind zu beobachten?
· FF3: Welche „Lehren“ können aus den beobachteten Unterschieden gezogen werden?
Methoden:
FF1: Dokumentenanalyse
FF2: Die Analyse des Zusammenhangs zwischen der Entwicklung der Evidenz und der Anzahl der Fälle aus den englischen, französischen und österreichischen Krankenhäusern wird in ähnlicher Weise durchgeführt, wie jene in Bezug auf deutsche Krankenhäuser (siehe oben). Die Krankenhausfälle werden über die Prozedurenkodes in den englischen, französischen und österreichischen Fallzahldaten seit 2005 identifiziert.
Die Analyse eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Entwicklung der Evidenz und der Anzahl der Fälle wird deskriptiv durchgeführt, indem die Veröffentlichungen auf einer Ordinate mit der jeweiligen Evidenzstufe I-IV über die Zeit und die Anzahl der Fälle auf derselben Zeitachse für jedes Land und jedes Medizinprodukt geplottet werden.
FF3: Länderübergreifende Analyse
|
Periode |
Leistungen |
|
Oktober 2020-Februar 2021 |
Scoping, Datenbeschaffung |
|
März-Juni 2021 |
Dokumentenanalyse, Update der Evidenz der drei Verfahren (systematische Update-Suche relevanter Literatur 2018-2020); Datenanalyse von Nutzungsdaten aus AT, ENG, FR und vergleichende Analyse von Nutzungstrends |
|
Juli 2021 |
Verfassen einer Publikation |
|
August 2021 |
Peer review und Einreichung |
References:
[1] Godlee F. Why aren’t medical devices regulated like drugs? BMJ : British Medical Journal. 2018;363:k5032. DOI: 10.1136/bmj.k5032.
[2] Storz-Pfennig P., Schmedders M. and Dettloff M. Trials are needed before new devices are used in routine practice in Europe. BMJ : British Medical Journal. 2013;346:f1646. DOI: 10.1136/bmj.f1646.
[3] Krüger L. J. and Wild C. Evidence requirementsfor the authorization and reimbursement of high-risk medical devices in the USA, Europe, Australia and Canada. An analysis of seven high-risk medical devices. Vienna. Available from: https://eprints.aihta.at/1017/1/HTA-Projektbericht_Nr.73.pdf.
[4] British Standards Institution (BSI). New Medical Devices Regulation and IVD Regulation text published. [cited 30.01.2020]. Available from: https://www.bsigroup.com/en-GB/medical-devices/news-centre/enews/2017-Enews/New-Medical-Devices-Regulation-and-IVD-Regulation-text-published/.
[5] European Commission. Medical Devices. [cited 30.01.2020]. Available from: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations_en.
[6] Grossmann N., Wolf S., Rosian K. and Wild C. Pre-reimbursement: early assessment for coverage decisions. Wien Med Wochenschr. 2019;169(11-12):254-262. Epub 2019/02/07. Vorab-Erstattung: Fruhbewertungen fur Erstattungsentscheidungen. DOI: 10.1007/s10354-019-0683-1.
[7] Mad P., Geiger-Gritsch S., Hinterreiter G., Mathis-Edenhofer S. and Wild C. Pre-coverage assessments of new hospital interventions on Austria: methodology and 3 years of experience. International journal of technology assessment in health care. 2012;28(2):171-179. Epub 2012/05/09. DOI: 10.1017/s0266462312000025.
[8] Bachner F., Bobek J., Habimana K., Ladurner J., Lepuschutz L., Ostermann H., et al. Austria: Health System Review. Health Syst Transit. 2018;20(3):1-254. Epub 2018/10/03.
[9] Cylus J., Richardson E., Findley L., Longley M., O'Neill C. and Steel D. United Kingdom: Health System Review. Health Syst Transit. 2015;17(5):1-126. Epub 2016/04/07.
[10] Chevreul K., Berg Brigham K., Durand-Zaleski I. and Hernandez-Quevedo C. France: Health System Review. Health Syst Transit. 2015;17(3):1-218, xvii. Epub 2016/01/15.
[11] Busse R. and Blümel M. Germany: Health System Review. 2014 [cited 18.05.2021]. Available from: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/germany-health-system-review-2014.
[12] Robausch M. and Emprechtinger R. Perkutaner Aortenklappenersatz in Österreich (Teil II). 2017 [cited 15.12.2020]. Available from: https://eprints.aihta.at/1141/1/HTA-Projektbericht_Nr.95b.pdf.