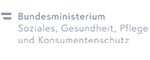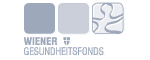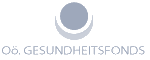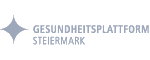Gezielte Therapie der drohenden Frühgeburt
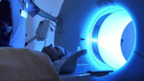
Philipp Mad
Laufzeit: ab September 2008
Literatursuche und –dokumentation: Tarquin Mittermayr
Vorgeschlagen von: KAGES
Publikation: HTA-Projektbericht 30 - https://eprints.aihta.at/825
Hintergrund:
Frühgeburtlichkeit ist mit erhöhter Mortalität und erhöhtem Risiko für bleibende Schäden beim Neugeborenen verbunden. Eine der auslösenden Ursachen für die erhöhte Mortalität von Frühgeborenen liegt in der unreifen Lunge, die zu der Entwicklung eines Atemnotsyndromes des Früh- und Neugeborenen (IRDS) führen kann, bei dem oft künstliche Beatmung und intensivmedizinische Maßnahmen notwendig werden. Deshalb versucht man bei drohender Frühgeburt in der 24. – 34. Schwangerschaftswoche, mittels mütterlicher Verabreichung von Kortison vor der Geburt die Lunge des Kindes zu reifen („Lungenreifung“). Bei einer Zeitspanne von 48 Stunden bis 7 Tagen zwischen Lungenreifung und Geburt konnte der größte Nutzen für die Neugeborenen nachgewiesen werden.
Eine häufig angewandte Strategie, um einen Geburtsfortschritt bei drohender Frühgeburt hinauszuzögern, ist die Verordnung von strenger Bettruhe. Ein Cochrane Review aus dem Jahr 2003 zeigte jedoch in diesem Zusammenhang, dass es keine Evidenz für oder gegen die Wirksamkeit von der Verordnung von Bettruhe gibt, es konnte hierzu nur eine Arbeit unklarer methodischer Qualität gefunden werden.
Eine medikamentöse Hemmung der Wehentätigkeit (Tokolyse) bei drohender Frühgeburt kann nicht die Ursache beheben, sondern meist nur den Zeitpunkt der Geburt etwas hinauszögern. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, die drohende Frühgeburt mittels Tokolyse hinauszuzögern:
- Verzögerung der Geburt um zumindest 48 Stunden, um eine Lungenreifung des Kindes zu ermöglichen
- Ermöglichung des Transportes der Mutter in ein Schwerpunktkrankenhaus vor der Entbindung
- Verlängerung der Schwangerschaft, wenn bekannte selbstlimitierende Zustände für die Auslösung der vorzeitigen Wehen verantwortlich sind (z.B. Pyelonephritis, Abdominalchirurgie)
Zur Tokolyse stehen mehrere Wirkstoffgruppen zur Verfügung, wobei in der klinischen Praxis in Österreich heute vorwiegend das Betasympathikomimetikum Hexoprenalin (Gynipral®, Nycomed Austria, Linz) und der Oxytocin-Rezeptorenblocker Atosiban (Tractocile®, Ferring, Limhamn, Schweden) verwendet werden. In Cochrane-Reviews aus den Jahren 2004 und 2005 zeigten die beiden Substanzen ähnliche Wirksamkeit bei deutlich höheren Nebenwirkungsraten von Hexoprenalin, die größtenteils durch die betasympathomimetische Wirkung auf das Herzkreislaufsystem zustande kommen. Ein Benefit für die Neugeborenen durch Tokolyse konnte in beiden Reviews nicht gefunden werden.
Die durch Atosiban verursachten Kosten für die Krankenhausträger sind deutlich höher als bei Hexoprenalin; es konnte in der letzten Zeit ein deutlicher Zuwachs in der Verwendung von Atosiban in einigen Krankenanstalten beobachtet werden.
Studienziele:
Synthese evidenzbasierter Leitlinien zur Indikationsstellung der medikamentösen Tokolyse sowie der Anwendungsbereiche von Atosiban, Hexoprenalin und verordneter BettruheZusammenfassung der Evidenz zur Wirksamkeit der Tokolytika Atosiban und Hexoprenalin bzw. verordneter Bettruhe bei drohender FrühgeburtSystematischer Review zu Kosten-Effektivitäts-Analysen von Atosiban und Hexoprenalin.
Fragestellungen:
zu 1) Zur Indikationsstellung und Anwendungsbereiche der Tokolyse:
a. Wann ist bei drohender Frühgeburt die Indikationsstellung zur medikamentösen Tokolyse gegeben?
b. Worin bestehen die Vor-/Nachteile von Atosiban vs. Hexoprenalin?
c. Für welche Patientinnengruppe ist Hexoprenalin indiziert, für welche Atosiban?
zu 2) Welche Evidenz besteht zur Wirksamkeit von Atosiban, Hexoprenalin bzw. verordneter Bettruhe bei drohender Frühgeburt?
zu 3) Welche Evidenz besteht zur Kosteneffektivität von Hexoprenalin, Atosiban und verordneter Bettruhe bei drohender Frühgeburt?
Methodik:
zu 1) Systematische Übersicht internationaler evidenzbasierter Leitlinien zur Tokolyse bei drohender Frühgeburt
zu 2) Ergänzung der Datenlage der Cochrane-Reviews zu Atosiban, Betasympathomimetika bzw. Bettruhe (Stand der Datenlage der Reviews ist 2004 - 2006) durch Suchen nach rezenten Studien mittels der gleichen Suchstrategie.
zu 3) Systematische Übersicht von Kosten-Effektivitätsanalysen, welche Atosiban und Hexoprenalin beinhalten