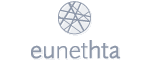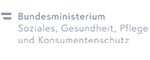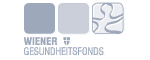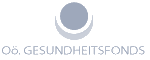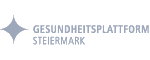- Aktuelles
- Newsletter
- Newsletter Jänner 2015 | Nr. 133
- Gründung des Forschungs- und Kompetenznetzwerkes Lebensende
Gründung des Forschungs- und Kompetenznetzwerkes Lebensende
Im Sommer 2014 wurden vier Wissenstransferzentren (WTZ) an heimischen Universitäten im Rahmen des vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) ins Leben gerufenen Programms „Wissenstransferzentrum und IPR-Verwertung“ gegründet. Ziel dieser Zentren ist die Vernetzung wissenschaftlicher Einrichtungen sowie das Zugänglichmachen und die Weitergabe wissenschaftlicher Erkenntnisse an die Gesellschaft. Einer der Schwerpunkte dieses Programms ist erstmals der geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche Bereich. Dabei steht die Forcierung sozialer Innovationen zur Lösung gesellschaftlicher Fragestellungen und Probleme im Mittelpunkt.
Gerade die vielschichtigen Fragestellungen zum Thema Lebensende lassen sich nicht mit einem monodisziplinären Zugang adäquat erfassen. Sie betreffen neben den medizinischen Fächern eine Reihe weiterer Disziplinen, wie etwa Rechts- und Sozialwissenschaften, Psychologie, aber auch theologische und philosophische Ethik. Deshalb sind transdisziplinäre Kooperationen und Wissenstransfer erforderlich, um der Komplexität der Situationen am Lebensende gerecht zu werden. Ein langfristiges Ziel, welches im Rahmen des Kooperationsprojektes angestrebt wird, ist die Etablierung eines österreichischen Forschungsschwerpunktes zum Thema Lebensende nach dem Vorbild des Schweizer Nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende (www.nfp67.ch). Inhaltliche Kernpunkte eines zukünftigen Forschungsschwerpunkts in Österreich könnten unter anderem folgende Punkte berücksichtigen: Sterbeverläufe und Versorgung; Entscheidungen, Motive und Haltungen während des Sterbeprozesses und zugrunde liegende Beweggründe; Konzepte eines „würdevollen“ Sterbens; kulturelle Leitbilder und gesellschaftliche Ideale.
Das Forschungs- und Kompetenznetzwerk Lebensende wird von wissenschaftlichen Mitarbeitern/innen der Medizinischen Universität Graz (Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie) und der Karl-Franzens Universität Graz (Institut für Moraltheologie) unter Beteiligung des Ludwig Boltzmann Instituts (LBI Health Technology Assessment, Wien) umgesetzt. Die Koordination liegt beim Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie Graz mit Willibald J. Stronegger als Projektleiter.
Der erste Schritt welcher im Bereich des Wissenstransfers dieses Projektes gesetzt wird, beinhaltet die Organisation und Abhaltung einer wissenschaftlichen Tagung zum Thema „Entscheidungen am Lebensende und ihr Kontext – Medizinethische und empirische Forschung im Dialog“. Der wissenschaftliche Diskurs zwischen normativer und empirischer Forschung zum Thema Lebensende ist erst im Anfangsstadium. Die Tagung versucht daher eine fruchtbare Annäherung zwischen Forschungsansätzen und beteiligten Fächern anzuregen. Die folgenden vier Themenblöcke werden aus ethischer und empirischer Perspektive behandelt werden:
A. Widersprüchliche Rationalitäten für Entscheidungen am Lebensende im interkulturellen Kontext
B. Institutionalisierung der Sterbebegleitung als Teil des modernen Medizinsystems und Wohlfahrtsstaates (institutioneller Kontext)
C. Autonomie am Lebensende – Normative Idee und Praktiken vor Ort
D. Fürsorge am Lebensende – Das Individualwohl im gesellschaftlich-ökonomischen Kontext
Die Tagung wird am 13. und 14. April 2015 am Universitätszentrum Theologie in Graz stattfinden. Renommierte nationale und internationale Vortragende werden referieren. Für nähere Informationen zur Tagung und/oder zum Projekt besuchen Sie bitte unsere Tagungshomepage (www.tagung-lebensende.at).
Nach Ablauf der ersten Projektlaufzeit (32 Monate) soll das Forschungs- und Kompetenznetzwerk etabliert und sollen offene bzw. aktuelle Forschungsfragen identifiziert sein. Zur Beteiligung sind alle in der Forschung zum Lebensende tätigen Personen bzw. Institutionen in Österreich eingeladen.
Univ.-Prof. Mag. Dr. Willibald J. Stronegger, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Medizinische Universität Graz
Dr.in Franziska Großschädl, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Medizinische Universität Graz