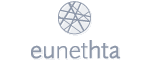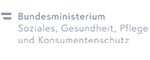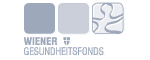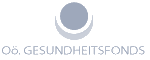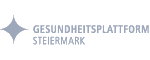Screening auf Diabetes mellitus: Leitlinien-Empfehlungen

Projektleitung: Claudia Wild
Projektbearbeitung: Thomas Semlitsch, Karl Horvath, Klaus Jeitler, Cornelia Krenn
(alle IAMEV)
Laufzeit: April 2019 – Juli 2019
Sprache: Deutsch
Publikation: LBI-HTA Projektbericht Nr. 118: https://eprints.aihta.at/1213/
Hintergrund:
Diabetes mellitus stellt eine weltweit rasch zunehmende Erkrankung dar. Im Österreichischen Diabetesbericht 2017 wird die Anzahl an Personen mit Diabetes mellitus in Österreich auf etwa 7 bis 11 % geschätzt, wobei angenommen wird, dass rund 30-35% davon nicht diagnostiziert sind. Als Diabetes mellitus werden grundsätzlich jene Stoffwechselerkrankungen bezeichnet, die durch eine chronische Hyperglykämie, d.h. einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnete sind. Dabei unterscheidet man, anhängig von der Ursache, vier Typen – Diabetes mellitus Typ 1, Diabetes mellitus Typ 2, Gestationsdiabetes sowie andere spezifische Diabetestypen. Pathophysiologisch beruht der Diabetes mellitus auf einer verminderten Insulinausschüttung und/oder einer gestörten Insulinwirkung (Insulinresistenz).
Die Behandlung des Diabetes mellitus zielt daher individuell angepasst auf die Erreichung von Symptomfreiheit und die Verhinderung akuter Komplikationen sowie schwerwiegender Folgeerkrankungen ab. Dabei sind Schulungsprogramme und eine adäquate kontinuierliche und strukturierte Betreuung der PatientInnen mit Diabetes mellitus für einen langfristigen Therapieerfolg hilfreich. Hierzu ist österreichweit für PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 2 das Disease-Management-Programm (DMP) „Therapie Aktiv“ umgesetzt. Grundsätzliche Therapieoptionen, abhängig vom Diabetes mellitus Typ, sind Lebensstilmaßnahmen, medikamentöse Therapien und Schulungen. Bei bestimmten Formen des Diabetes mellitus, wie bei Diabetes mellitus Typ 1, ist immer eine medikamentöse Therapie mit Insulin indiziert.
Unter der Bezeichnung „Screening“ versteht man Untersuchung zur systematischen Erfassung von Erkrankungen in noch beschwerdefreien Krankheitsvor- oder Frühstadien. Sie werden dabei eingesetzt, um Erkrankungen noch vor dem Auftreten von Symptomen zu diagnostizieren, um diese so bereits frühzeitig durch geeignete Maßnahmen behandeln zu können. Die Vorrausetzungen für eine sinnvolle Durchführung eines Screenings auf eine Erkrankung werden dabei durch folgende fünf Mindestvoraussetzungen definiert:
- Die Erkrankung stellt ein wichtiges allgemeines Gesundheitsproblem dar.
- Es liegt ein frühes asymptomatisches Stadium für die Erkrankung vor.
- Es gibt einen geeigneten Screening-Test.
- Eine anerkannte Behandlung ist verfügbar.
- Eine frühzeitige Behandlung in der asymptomatischen Phase verbessert das Langzeitergebnis.
Diabetes mellitus scheint zwar grundsätzlich die meisten dieser Anforderungen für ein allgemeines Screening zu erfüllen, jedoch konnte in Studien bisher nicht eindeutig gezeigt werden, dass ein Screening sowie frühzeitige Interventionen langfristige patientenrelevante Endpunkte verbessern. Daher soll im Rahmen dieses Projekts erhoben werden, inwieweit ein allgemeines Screening bzw. ein auf bestimmte Populationen eingeschränktes Screening auf Diabetes mellitus in aktuellen internationalen evidenzbasierten Leitlinien empfohlen wird.
Projektziel und Forschungsfragen:
Ziel des Projektes ist es Empfehlungen zu einem Screening auf Diabetes mellitus in aktuellen internationalen evidenzbasierten Leitlinien zu identifizieren, zu extrahieren und zu analysieren.
Dabei sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:
- Wird in internationalen evidenzbasierten Leitlinien ein generelles Screening der Allgemeinbevölkerung auf Diabetes mellitus empfohlen?
- Wird in internationalen evidenzbasierten Leitlinien ein Screening auf Diabetes mellitus für bestimmte Bevölkerungsgruppen empfohlen? Wenn ja, für welche?
- Wenn in internationalen evidenzbasierten Leitlinien ein Screening auf Diabetes mellitus empfohlen wird, mit welchen Screening-Tests soll dies erfolgen?
- Welchen Stellenwert haben Harnstreifen-Tests im Rahmen eines Diabetes-Screenings gemäß den internationalen evidenzbasierten Leitlinien?
Methoden:
Leitlinien-Recherche: Eine fokussierte Recherche nach aktuellen und thematisch relevanten Leitlinien erfolgt in folgenden Quellen:
- Leitliniendatenbanken: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und Guidelines International Network (G-I-N)
- Fachübergreifende Leitlinienanbieter: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
- Bibliographische Datenbank: PubMed
- Internetrecherche via Google
Die Recherche wird dabei auf englisch- bzw. deutschsprachige Leitlinien zum Thema Diabetes mellitus eingeschränkt.
Selektion relevanter Leitlinien: Die im Rahmen der Recherche identifizierten Leitlinien werden von 2 ReviewerInnen unabhängig voneinander hinsichtlich ihrer Relevanz geprüft. Dabei müssen alle nachfolgend in Tabelle 1 genannten Einschlusskriterien erfüllt sein. Diskrepanzen in der Einschätzung zwischen den ReviewerInnen werden ggf. im Konsens oder durch eine/n dritte/n ReviewerIn gelöst.
Einschlusskriterien Leitlinien
|
Population |
Personen jeglichen Alters und Geschlechts mit Diabetes mellitus |
|
Inhalte
|
Die Leitlinie bezieht sich spezifisch auf ein Screening nach Diabetes mellitus oder auf die Prävention und/oder Therapie des Diabetes mellitus allgemein. Leitlinien zu einzelnen spezifischen Aspekten der Diabetesversorgung (z.B. Therapie von Fußkomplikationen oder medikamentöse blutzuckersenkende Therapie) werden nicht berücksichtigt. |
|
Übertragbarkeit
|
Es werden nur Leitlinien berücksichtigt, deren Empfehlungen auf das österreichische Gesundheitswesen übertragbar sind. Eingeschlossen werden daher ausschließlich Leitlinien aus Industrienationen gemäß der Staateneinteilung des Weltgesundheitsberichts 2003 der WHO (Stratum A) [15] |
|
Evidenzbasierung und Empfehlungs-kennzeichnung |
Es werden nur evidenzbasierte Leitlinien eingeschlossen und somit Leitlinien, die ihre
Empfehlungen müssen formal eindeutig als solche erkennbar sein. |
|
Publikationssprache |
Englisch oder Deutsch |
|
Publikationszeitpunkt / Gültigkeit |
Publikationszeitpunkt ab 2014, die Leitlinie ist aktuell und das Überarbeitungsdatum wurde nicht überschritten. |
Extraktion und Gegenüberstellung relevanter Empfehlungen: Aus den eingeschlossenen Leitlinien werden alle formal erkennbaren Empfehlungen mit Bezug auf ein Screening auf Diabetes mellitus bzw. auf die entsprechenden Screeningverfahren extrahiert. Neben dem Inhalt der Empfehlung werden, soweit eindeutig zuordenbar, der dazugehörige Empfehlungsgrad (Grade of Recommendation bzw. GoR) bzw. die jeweilige Evidenzstufe (Level of Evidence bzw. LoE) dokumentiert. Wenn möglich und sinnvoll, wird darüber hinaus die der Empfehlung zugrundeliegende Evidenz erhoben, soweit Angaben dazu in den Leitlinien vorliegen.
Anschließend erfolgt in einer strukturierten Informationssynthese eine inhaltliche Gegenüberstellung der Empfehlungen aus einzelnen inkludierten Leitlinien. Liegen aus einzelnen Leitlinien widersprüchliche Empfehlungen vor, werden diese Inkonsistenzen anhand der in den Leitlinien dargestellten den Empfehlungen zugrundliegenden Evidenz analysiert. Werden dadurch Aspekte identifiziert, die die Inkonsistenz inhaltlich erläutern können, werden diese Im Bericht entsprechend dargestellt und gegebenenfalls diskutiert.
Zeitplan:
Der nachfolgende Zeitplan enthält die Arbeitsschritte, die im Rahmen des Projekts anfallen.
|
Arbeitsschritte |
2019 |
||
|
Mai |
Juni |
Juli |
|
|
Literaturrecherche nach relevanten Leitlinien |
|
|
|
|
Screening nach Titel, Abstract und Volltext |
|
|
|
|
Extraktion der relevanten Empfehlungen |
|
|
|
|
Gegenüberstellung und deskriptive Analyse der Empfehlungen |
|
|
|
|
Berichterstellung |
|
|
|
Literatur:
Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, et al. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract. 2014; 103 (2): 137-49.
Klimont J, Baldaszti E. Österreichische Gesundheitsbefragung 2014 - Hauptergebnisse des Austrian Health Interview Survey (ATHIS) und methodische Dokumentation. Available from: http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=105602 [cited 13.05.2019].
Schmutterer I, Delcour J, Griebler R. Österreichischer Diabetesbericht 2017. Available from: https://jasmin.goeg.at/327 [cited 13.05.2019].
Bundesärztekammer KB, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Nationale VersorgungsLeitlinie: Therapie des Typ-2-Diabetes; Langfassung; Version 4. Available from: https://www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/diabetes-mellitus/dm-therapie-1aufl-vers4-lang.pdf. [cited 13.05.2019].
American Diabetes A. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019; 42 (Suppl 1): S13-S28.
American Diabetes A. 1. Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Medical Care in Diabetes-2019.
Bundesministerium für Arbeit S, Gesundheit und Konsumentenschutz. Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs - Screening. Available from: https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/s/lexikon-screening [cited 14.05.2019].
Wilson J, Junger G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: World Health Organization; 1968.
McCulloch D, Hayward R. UpToDate: Screening for type 2 diabetes mellitus. Available from: https://www.uptodate.com/contents/screening-for-type-2-diabetes-mellitus?search=screening-for-type-2-diabetes-mell...1&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 [cited 13.05.2019].
World Health Organization (WHO). The World Health Report 2003: Shaping The Future 2003: Available from: http://www.who.int/whr/2003/en/whr03_en.pdf [cited Access Date].