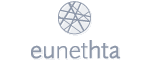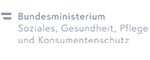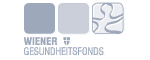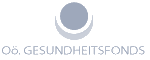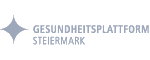Systematische Übersicht zu Evaluierungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Projektbearbeitung: Ingrid Zechmeister-Koss
Laufzeit: Oktober 2008 - November 2009
Projektleitung: Roman Winkler (Gesamtprojekt und Projektteil: „Evaluierungen im Kontext von Therapieangeboten und –verläufen“, LBI-HTA-Projektbericht 27)
Projektmitarbeit: Philipp Radlberger und Ingrid Zechmeister (Projektteil: „Ökonomische Evaluierungen“, LBI-HTA-Projektbericht 28)
Literatursuche und –dokumentation: Tarquin Mittermayr
Vorgeschlagen von: SALK, BMG, TILAK, KAGES
Publikationen:
HTA-Projektbericht 27: Evaluierungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie- Theorie und Praxisbeispiele zu Bewertungsdimensionen, Indikatoren und Instrumenten (Roman Winkler) - https://eprints.aihta.at/846
HTA-Projektbericht 28: Kinder- und Jugendpsychiatrie: Gesundheitsökonomische Evaluationen (Philipp Radlberger) - https://eprints.aihta.at/862
Laufzeit: 10/2008 – 11/2009
Hintergrund:
Die Behandlung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen erfolgt zumeist auf Basis eines umfangreichen Therapiekonzepts, welches abgestimmt auf das Krankheitsbild und den Leidensdruck der PatientInnen, die medizinische, psychotherapeutische und sozialpädagogische Versorgung miteinschließt. Die Forschungslücken, die sich in diesem Zusammenhang stellen, beziehen sich primär auf Evaluierungen des Behandlungserfolgs (Verbesserung der klinischen Symptomatik, Lebensqualität) und der -zufriedenheit seitens der PatientInnen bzw. Angehörigen mit den Therapieangeboten. Darüber hinaus zeigt sich Forschungsbedarf an sozio-ökonomischen Langzeit-Outcomes von Therapieangeboten etwa in Hinblick auf den Schulerfolg von psychiatrisch kranken Kindern und Jugendlichen oder die (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt bei Jugendlichen. Nicht zuletzt besteht ein Mangel an ökonomischen Evaluationen, die die Therapieergebnisse in Relation zum nötigen Ressourcenbedarf stellen.
Ziele und Fragestellungen:
Das Forschungsprojekt verfolgte das Ziel, eine systematische Literaturübersicht zur Methodik der Evaluierung von Therapieangeboten zu erstellen, die eingesetzten Erhebungsinstrumente zu identifizieren, sowie die Therapieergebnisse (publizierte Evaluationen) hinsichtlich der Ergebnisparameter (klinische Symptomatik, Lebensqualität, Behandlungszufriedenheit der PatientInnen und Angehörigen mit den Therapieangeboten und –verläufen, sozio-ökonomische Langzeit-Outcomes und Kosteneffektivität) systematisch zu analysieren.
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Kernfragen als Orientierungsrahmen für die Übersichtsarbeit formuliert:
Anhand welcher Indikatoren und mit welchen Methoden und Erhebungsinstrumenten werden psychiatrische Therapieangebote für Kinder und Jugendliche im internationalen Kontext evaluiert? (LBI-HTA-Projektbericht 27)Welche Therapieergebnisse wurden in internationalen Studien bereits festgestellt und können als „Benchmarks“ für österreichische Therapieangebote identifiziert werden? Welche sozio-ökonomischen Langzeit-Outcomes wurden empirisch erhoben? (LBI-HTA-Projektbericht 27)Wie stellen sich die Kosten und Kosteneffektivitäts- bzw. Kostennutzenrelationen in ökonomischen Evaluierungen dar? (LBI-HTA-Projektbericht 28).
Methoden:
Systematische Literaturrecherche nach Studien/Berichten/Gutachten in medizinischen Portalen (Ovid Medline, Embase, CRD Datenbanken, PsycINFO, EconLit, ISI Web of Science.) im Zeitraum von 1985-2009 sowie Handsuche. Analyse, Bewertung der vorhandenen Literatur, systematischer Review.
Ergebnisse – Evaluierungen im Kontext von Therapieangeboten und -verläufen: :
Der Behandlungserfolg, die –zufriedenheit und die Lebensqualität psychiatrisch erkrankter Kinder und Jugendliche konnten im Zuge der Literaturübersicht (14 eingeschlossene Studien) als primäre Evaluierungsdimensionen identifiziert werden. Die Operationalisierung dieser Dimensionen erfolgte anhand von Evaluierungsindikatoren. Dabei erwies sich die klinische Symptomatik als ein zentraler Gradmesser für die medizinischen, psychotherapeutischen und psycho-sozialen Behandlungsprogramme. Die Qualität des Behandlungsverlaufes sowie die “Kommunikationskultur“ zwischen den einzelnen AkteurInnen erwiesen sich wesentlich für die Bestimmung der Behandlungszufriedenheit. Damit eng verknüpft ergaben sich Bewertungsaspekte für die Lebensqualität der PatientInnen und ihrer nahestehenden Angehörigen. Hierbei wurden v.a. Indikatoren angewandt, die die „Ressourcentiefe“ der Befragten erhoben (z.B. Umfang an Bewältigungsstrategien in Krisensituationen; Reichweite von persönlichen Netzwerken etc.). Die empirische Überprüfung dieser Indikatoren erfolgte in der überwiegenden Studienmehrheit mittels standardisierter Instrumente, wobei sich das „Marburger System zur Qualitätssicherung und Therapieevaluation (MARSYS)“ als besonders umfassend erwies. Hinsichtlich der primären Studienergebnisse zeigte sich, dass die Evaluierungsinstrumente mehrheitlich auf eine Verbesserung der klinischen Symptomatik hinwiesen (eine tatsächliche Remission wurde in den eingeschlossenen Studien allerdings nur selten genannt). Als integralen Erfolgsfaktor für das Eintreten von klinischen Verbesserungen wurde v.a. in Hinblick auf die Dimensionen Behandlungszufriedenheit und Lebensqualität, die „Beziehungsarbeit“ von den StudienautorInnen genannt.
Ergebnisse – Ökonomische Evaluierungen: :
Über einen Beobachtungszeitraum von 25 Jahren konnten ein systematischer Review und 25 Einzelstudien identifiziert werden. Einzelne Indikationen, wie etwa ADHS, sind besser beforscht als andere. Auf der Ebene der Interventionen existiert beispielsweise ein Ungleichgewicht zugunsten der kognitiven Verhaltenstherapie. Die meisten Studien sind Kosteneffektivitätsstudien. Die Kosteneffektivitätsergebnisse der untersuchten Interventionen sind im Vergleich zu evaluierten Interventionen in der somatischen Medizin niedrig, also günstig. Die Mehrzahl der identifizierten Studien ist methodisch wenig transparent. Dies trifft insbesondere auf die Informationen zu Kostenerhebung und Modellierung zu. Die Übertragbarkeit der Studien ist aufgrund kontextspezifischer Interventionen eingeschränkt. Was die Erhebung der Kostendaten betrifft, so wird zumeist die Perspektive der öffentlichen Kostenträger bzw. der Versicherungen eingenommen. Es existieren jedoch auch weiter reichende Erhebungsinstrumente, wie etwa der ‚Client Service Receipt Inventory’, mit dem zusätzlich zu den Kosten im Gesundheitssystem auch Kosten in anderen gesellschaftlichen Sektoren oder private Kosten erfasst werden.
Weiterführende Forschung:
Auf Basis dieser „theoretischen“ Aufarbeitung von klinischen und ökonomischen Evaluierungsstudien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde im Anschluss in Kooperation mit der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik (Salzburg) eine Evaluierungsstudie konzipiert. Im April 2011 wurde mit der Primärdatenerhebung begonnen, die großteils auf jenen Ergebnisparametern basiert, die in der systematischen Übersicht identifiziert wurden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Evaluierungsprojekts auch eine ökonomische Evaluierung durchgeführt. Für nähere Infos zum laufenden Projekt (Laufzeit 01/2010 bis 12/2012).