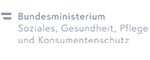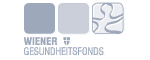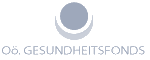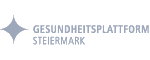Transitionspsychiatrie: Analyse und Vergleich internationaler Modelle

Projektleitung: Romy Schönegger
Projektbearbeitung: Romy Schönegger, Yui Hidaka
Laufzeit: Februar 2025 – November 2025
Sprache: Englisch (mit deutscher Zusammenfassung)
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 177: https://eprints.aihta.at/1574/
Hintergrund:
Der Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie [KJP] in die Erwachsenenpsychiatrie [EP] stellt eine kritische Phase dar, die jedoch nach wie vor fragmentiert ist und aufgrund unzureichender Koordination und Zugangsbarrieren häufig zu Versorgungsbrüchen führt [1]. Studien zeigen, dass bis zu 45% der Patient:innen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Weiterbehandlung in der Erwachsenenpsychiatrie benötigen [2], jedoch mehr als die Hälfte dieser Patient:innen die Behandlung abbricht und nur ein kleiner Teil einen optimalen Übergang erfährt [3-5].
Trotz internationaler Bemühungen wie dem MILESTONE-Projekt, das Schlüsselelemente für erfolgreiche Transitionen identifiziert hat, darunter frühzeitige Planung, Zusammenarbeit, Integration der Dienste und Kontinuität der Versorgung [3], ist die Umsetzung nach wie vor uneinheitlich. Die MILESTONE-Untersuchung in 28 Ländern ergab, dass 2018 nur zwei Länder, Dänemark und das Vereinigte Königreich, über nationale oder regionale Richtlinien verfügten, was auf weit verbreitete politische und strukturelle Lücken in der Transitionspsychiatrie hinweist [1].
Vorliegende Forschungsergebnisse aus Österreich bestätigen diese Problematik: 98,8% der Expert:innen beurteilen das System als unzureichend und nur 16,3% geben an, an ihrem Arbeitsplatz über strukturierte Transitionsprotokolle zu verfügen [2]. Darüber hinaus sind 70,9% der Meinung, dass der Übergang für die Patient:innen schwer zu bewältigen sei [2]. Expert:innen betonen daher die Bedeutung integrierter Versorgungsansätze, einer verbesserten Kommunikation zwischen KJP und EP, einer angemessenen Ressourcenverteilung bzw. -schaffung, sowie gesetzlicher Richtlinien [2, 6, 7]. Schließlich wird in einem Review aus dem Jahr 2024 festgestellt, dass es noch viel darüber zu lernen gibt, wie man Übergänge effektiv und effizient gestalten kann, und dass nur vorläufige Ergebnisse zur Kosteneffizienz von Transitionsprotokolle vorliegen [8].
Projektziel und Forschungsfragen:
Ziel des Projektes ist es, internationale Modelle und Strategien der Transitionspsychiatrie systematisch auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in struktureller Organisation, Merkmalen, Umsetzungsstrategien und Ressourcenverteilung zu analysieren und zu vergleichen sowie die Identifizierung von förderlichen und hinderlichen Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Auf Basis dieser Analyse sollen Empfehlungen für die Implementierung, Evaluierung und Weiterentwicklung der Transitionspsychiatrie in Österreich abgeleitet werden.
Ziel dieser Studie ist es nicht, einen detaillierten Umsetzungsplan zu entwickeln oder eine Wirksamkeitsanalyse für spezifische Interventionen oder eine Budget-Impact-Analyse durchzuführen. Vielmehr soll die Studie strukturelle Vergleiche anstellen und eine Wissensbasis für die Entscheidungsfindung bereitstellen.
- FF1: Welche internationalen und länderübergreifenden Strategien und Modelle der Transitionspsychiatrie gibt es, und worin bestehen ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
- FF2: Welche besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse sind mit der Transition von jungen Erwachsenen mit spezifischen psychischen Problemen verbunden?
- FF3: Wie steht der österreichische Ansatz im Vergleich zu internationalen Modellen der Transitionspsychiatrie und welche Empfehlungen lassen sich ableiten, um die österreichische Transitionspsychiatrie mit internationalen Modellen und Strategien in Einklang zu bringen?
Methode:
Zur Beantwortung der Forschungsfragen kommen folgende Methoden zum Einsatz:
- FF1: strukturierte Länderauswahl und länderübergreifende Organisationen; strukturierte Handsuche nach internationalen Modellen/Strategien zur Transitionspsychiatrie; kritische Bewertung der einbezogenen Berichte durch eine an den Schwerpunkt des Projekts angepasste Version von AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation); Identifizierung von Expert:innen (politische Entscheidungsträger:innen / Gesundheitsfachpersonal / Forscher:innen) durch gezielte Stichproben, Expert:innenbefragungen (mündlich oder schriftlich) zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse mit Hilfe eines (halb-)strukturierten Fragebogens; strukturierte Datenextraktion zu Schlüsselinformationen (einschließlich grundlegender Informationen zum Modell, Anwendungsbereich und Zielpopulation, Integration und Koordinierung der Dienste, Behandlungsansatz, Personal- und Ausbildungsanforderungen, Umsetzung und Verwaltung, Kosten, sowie Evaluation); thematische Inhaltsanalyse auf der Grundlage der extrahierten Daten zur Ermittlung von Mustern und Lücken; narrative Synthese und Datenvisualisierung
- FF2: Auswahl von psychischen Erkrankungen; strukturierte Handsuche nach indikationsspezifischen Modellen in den ausgewählten Ländern; Identifizierung von Expert:innen und Konsultationen (mündlich oder schriftlich) für weitere Erkenntnisse durch (halb-)strukturierte Fragebögen; Datenextraktion von Schlüsselinformationen (einschließlich indikationsspezifischer Herausforderungen und Bedürfnisse für die Transition, bestehende Strategien, spezialisierte Transitionsdienste, Lücken und Grenzen); thematische Synthese
- FF3: Bedarfsanalyse; strukturierte Handsuche für Überblick über die aktuelle Versorgungssituation in Österreich; Identifizierung von Expert:innen und Konsultationen (mündlich oder schriftlich) für weitere Erkenntnisse durch (halb-)strukturierte Fragebögen; Datenextraktion; kontextbezogene vergleichende Analyse (zusammengefasste FF1-Ergebnisse) für Policy-Mapping-Analyse (um wichtigsten politischen Dimensionen zu definieren und spezifische Lücken zu identifizieren); vergleichende Tabellendarstellung; Ableitung von Empfehlungen für jede identifizierte Kategorie zur Verbesserung der Kontinuität der Versorgung und Sicherstellung von nachhaltigen personellen Ressourcen und Qualifikationen unter Berücksichtigung von förderlichen und hinderlichen Faktoren und kontextuellen Rahmenbedingungen; strukturierter Rahmen zur Kategorisierung der Empfehlungen; Visualisierung
Datenbanken für die Suchstrategie (FF 1-3): Google/Google Scholar, WHO MiNDbank, Europe's Encyclopedia of National Youth Policies, nationalen Websites von Gesundheitsministerien, Public Health und Richtlinieninstitutionen, TRIP Database, Guidelines International Network, Website-Ressourcen von länderübergreifenden Organisationen
Inklusionskriterien für die Länderauswahl (FF1)
|
Kriterien |
Inklusionskriterien |
Exklusionskriterien |
|
1. Gesundheitssystem |
Bismarck-Gesundheitssysteme mit bestehenden Leitlinien für die Übergangspsychiatrie |
Länder mit stark zentralisierten oder heterogenen Gesundheitssystemen (es sei denn, es gibt relevante Rahmenbedingungen für die Transitionspsychiatrie (siehe Kriterium 2)) |
|
2. Etablierte/Früh eingeführte Strategien zur Transitionspsychiatrie |
Länder mit fest etablierten/früh eingeführten nationalen Strategien/Interventionen zur Transitionspsychiatrie gemäß MILESTONE [1] oder WHO-Bericht [9] |
Länder ohne strukturierte Rahmenbedingungen für die Transitionspsychiatrie |
|
3. Forschung und Dokumentation |
Länder mit zugänglichen Daten, veröffentlichten Berichten |
Länder mit begrenzter oder nicht vorhandener politischer Dokumentation |
|
4. Bevölkerungsdichte |
Länder mit mehr als 5 Millionen Einwohner:innen |
Länder mit einer Bevölkerung von weniger als 5 Millionen |
|
5. Geographie |
Europäische Länder |
außereuropäische Länder, sofern sie keine fundierten Erkenntnisse liefern (z. B. Australien) |
|
6. Human Development Index |
Länder mit einem HDI gleich oder höher als Österreich (? 0,926, 2022 [10]) |
Länder mit einem HDI unter 0,926 |
Folgende sieben Länder werden für die Analyse herangezogen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich
Die ausgewählten Länder stellen Best-Practice-Modelle in der Transitionspsychiatrie dar, da sie entweder einen hohen Human Development Index (HDI) aufweisen, der Vergleichbarkeit der Kapazitäten des Gesundheitssystems, der Verfügbarkeit von personellen Ressourcen und der allgemeinen sozioökonomischen Bedingungen gewährleistet, oder strukturell dem Bismarck'schen Gesundheitssystem Österreichs ähnlich sind, was die politische Relevanz sicherstellt, oder frühzeitig strukturierte Strategien in der Transitionspsychiatrie eingeführt haben, welche langjährige und gut dokumentierte Beispiele der Transitionspsychiatrie bieten. Diese Auswahl stellt sicher, dass die Ergebnisse der Studie anwendbar, umsetzbar und informativ für die politische Entwicklung in Österreich sind.
Darüber hinaus werden WHO, UNICEF und OECD als länderübergreifende Organisationen miteinbezogen, da sie eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der globalen Politik zur psychischen Gesundheit (besonders bei Kindern und Jugendlichen) spielen.
Inklusionskriterien für die Auswahl psychischer Erkrankungen (FF2):
1. Hohe Dropout-Raten oder geringe Überweisung an die EP, wie von Reneses et al. [4] und/oder Singh et al. [3, 9] berichtet
2. Hohe Krankheitslast oder Prävalenz bei Jugendlichen (15-19 Jahre), gemäß der Global Burden of Disease Study (GBD) [10]
3. Im Transitionsalter auftretende/entstehende Krankheiten, basierend auf Daten der Global Burden of Disease Study [10]
FF2 wird sich auf Krankheiten beschränken, die mindestens zwei der oben genannten Kriterien erfüllen. Daher werden wir uns auf Angststörungen, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), depressive Störungen, Essstörungen, Substanzmissbrauchsstörung und Verhaltensstörungen konzentrieren.
Inklusionskriterien für relevante Modelle der Transitionspsychiatrie (FF1):
|
Kriterien |
Inklusion |
Exklusion |
|
1. Modelltyp |
Nationale oder transnationale Modelle/Strategien für die Transitionspsychiatrie, veröffentlicht von Regierungsbehörden, Gesundheitsorganisationen oder akademischen Einrichtungen |
Regionale Modelle (falls es nationale Modelle gibt), informelle oder inoffizielle Strategien |
|
2. Umfang der Transition |
Deckt den Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Erwachsenenpsychiatrie ab |
Maßnahmen für Transitionen in anderen Bereichen (z. B. Schule-Beruf) oder Maßnahmen, die sich nur auf Kinder (<18) oder Erwachsene (>25) beziehen |
|
3. Publikations Sprache |
Modelle verfügbar in Englisch, Deutsch oder den Landessprachen (wenn keine offizielle Übersetzung vorliegt, wird für wichtige politische Dokumente eine neuronale maschinelle Übersetzung verwendet) |
Richtlinien, die nur in Sprachen veröffentlicht werden, in denen eine neuronale maschinelle Übersetzung für die technische Auslegung nicht möglich ist |
|
4. Publikations Zeitraum |
Keine Einschränkung - alle historischen und aktuellen Modelle werden einbezogen, sofern sie noch relevant sind |
Überholte, ersetzte oder nicht mehr angewandte Richtlinien, sofern sie nicht für die Entwicklung der Transitionspsychiatrie von Bedeutung sind |
|
5. Modell Charakteristiken (vorläufig) |
Modelle müssen relevante (z. B. Altersspanne, Zielgruppen, Behandlungsansätze, professionelle Rollen, Dienstleistungskoordinierung und -verantwortung sowie Umsetzung) beschreiben |
Modelle, die wichtige Merkmale nicht spezifizieren |
Diese Studie bevorzugt nationale Modelle, soweit verfügbar. In Fällen, in denen nationale Rahmenwerke fehlen oder unzureichend sind, werden regionale Modelle berücksichtigt, um Datenlücken zu vermeiden. Regionale Modelle werden nur berücksichtigt, sofern kein nationales Modell in den ausgewählten Ländern gefunden werden kann, und werden durch eine unstrukturierte Handsuche identifiziert. Für diese Modelle gelten dieselben Einschlusskriterien wie für nationalen Modelle, um die Konsistenz der Analyse zu gewährleisten.
Zeitplan/Meilensteine:
|
Zeitraum |
Aufgaben |
|
Feb - Mar |
Scoping und Projektaufbau; Handsuche; Literaturauswahl und -aquisition; Dokumentenanalyse; |
|
Apr – Mai |
Dokumentenanalyse; Planung und Vorbereitung (halb-)strukturierter Expert:innenbefragung (Identifizierung der Teilnehmer:innen, Entwicklung eines Interviewleitfadens); Experte:innnbefragungen; Datenextraktion; |
|
Jun - Jul |
Experte:innnbefragungen; Thematische und vergleichende Analyse der internationalen Modelle (FF1 & FF2); Strukturierte Analyse Policy Mapping und Ableitung Empfehlungen (FF3); Bericht Entwurf; |
|
Aug – Okt |
Analyse der Ergebnisse/Entwicklung von politischen Empfehlungen (FF3); Berichterstellung; Interner und externer Review; Überarbeitung; Finalisierung; |
References:
[1] Signorini G., Singh S. P., Marsanic V. B., Dieleman G., Dodig-Curkovic K., Franic T., et al. The interface between child/adolescent and adult mental health services: results from a European 28-country survey. European Child & Adolescent Psychiatry. 2018;27(4):501-511. Epub 20180124. DOI: 10.1007/s00787-018-1112-5.
[2] Pollak E., Kapusta N. D., Diehm R., Plener P. L. and Skala K. Transitional and Adolescent Psychiatry in Austria: A Pilot Study on the Attitudes of Experts. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 2018;46(4):325-335. Epub 20171204. Transitions- und Adoleszenzpsychiatrie in Osterreich: Eine Pilotuntersuchung zur Sicht von Expert(innen). DOI: 10.1024/1422-4917/a000559.
[3] Singh S. P., Paul M., Ford T., Kramer T., Weaver T., McLaren S., et al. Process, outcome and experience of transition from child to adult mental healthcare: multiperspective study. The British Journal of Psychiatry. 2010;197(4):305-312. DOI: 10.1192/bjp.bp.109.075135.
[4] Reneses B., Escudero A., Tur N., Aguera-Ortiz L., Moreno D. M., Saiz-Ruiz J., et al. The black hole of the transition process: dropout of care before transition age in adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry. 2023;32:1285-1295. Epub 20220120. DOI: 10.1007/s00787-021-01939-8.
[5] Paul M., Ford T., Kramer T., Islam Z., Harley K. and Singh S. P. Transfers and transitions between child and adult mental health services. The British Journal of Psychiatry. 2013;54:s36-40. DOI: 10.1192/bjp.bp.112.119198.
[6] Trabi T., Purtscher-Penz K. and Plener P. The transition of psychiatric ill adolescents from child and adolescent psychiatric care to adult psychiatric care. neuropsychiatrie. 2023;37(1):26-32. Epub 20221121. Versorgung psychisch kranker Jugendlicher im Prozess der Transition vom Jugend- ins Erwachsenenalter. DOI: 10.1007/s40211-022-00441-0.
[7] Neumann M., Dürr A., Gonzalez-Martin A., Urban M., Manoharan N., Surikova V., et al. Mind the gap – Forderungen für eine verbesserte transitionspsychiatrische Versorgung aus Expert:innenperspektive. psychopraxis neuropraxis. 2024;27(4):245-250. DOI: 10.1007/s00739-024-01017-z.
[8] Adamo N., Singh S. P., Bolte S., Coghill D., Newcorn J. H., Parlatini V., et al. Practitioner Review: Continuity of mental health care from childhood to adulthood for youths with ADHD - who, how and when? The Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2024;65(11):1526-1537. Epub 20240716. DOI: 10.1111/jcpp.14036.
[9] World Health Organization [WHO]. World mental health report: transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization, 2022 [cited 10.02.2025]. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/356119/9789240049338-eng.pdf?sequence=1.
[10] United Nations Development Programme [UNDP]. Human Development Index (HDI). 2022.
[11] Singh S. P., Paul M., Ford T., Kramer T. and Weaver T. Transitions of care from Child and Adolescent Mental Health Services to Adult Mental Health Services (TRACK Study): a study of protocols in Greater London. BMC Health Services Research. 2008;8:135. Epub 20080623. DOI: 10.1186/1472-6963-8-135.
[12] Kieling C., Buchweitz C., Caye A., Silvani J., Ameis S. H., Brunoni A. R., et al. Worldwide Prevalence and Disability From Mental Disorders Across Childhood and Adolescence: Evidence From the Global Burden of Disease Study. JAMA Psychiatry. 2024;81(4):347-356. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2023.5051.