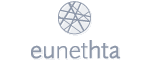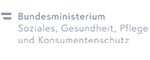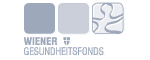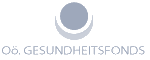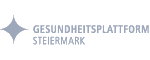Die ökonomische und soziale Dimension von elterlicher psychischer Erkrankung

Projektleitung: Christoph Strohmaier
Autor*innen: Christoph Strohmaier (Erstautor; AIHTA), Laura Hölzle (Zweitautorin; VILLAGE-Projekt)
Leitung Qualitätssicherung: Ingrid Zechmeister-Koss (AIHTA; Co-Investigator VILLAGE-Projekt); COIs VILLAGE-Projekt (Jean Paul, Annette Bauer, Melinda Goodyear, Hanna Christiansen)
Dauer: April bis September 2021
Sprache: Englisch mit Deutscher Zusammenfassung
This project is part of the 'Village Project'
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 142: https://eprints.aihta.at/1351/
Hintergrund: Vor 30 Jahren verabschiedete die UN-Vollversammlung die UN-Kinderrechtskonvention (KRK), in der die zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Rechte von Kindern festgeschrieben sind [1]. Auch in Österreich haben sich 2012 die Bundesgesundheitskommission und der Ministerrat auf 10 österreichische Gesundheitsziele geeinigt. Darunter auch das Bekenntnis, das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen unter Wahrung der gesundheitlichen Chancengleichheit sicherzustellen und die psychosoziale Gesundheit bestmöglich zu fördern [2].
50 bis 60 % der Personen mit einer schweren psychischen Erkrankung (SME) leben gemeinsam mit einem oder mehreren Kindern. Darüber hinaus zeigen internationale Schätzungen, dass etwa jedes fünfte minderjährige Kind mit einem Elternteil mit einer SME zusammen lebt [3-6]. Kinder, die in psychisch belasteten Familien aufwachsen, haben potentiell ein erhöhtes Risiko für eine ungünstige kindliche Entwicklung oder für die Entwicklung eigener körperlicher und psychischer Gesundheitsproblemen [7]. Zusätzlich kommt es öfter zu Lernschwierigkeiten, einer langfristigen Abhängigkeit von Sozialleistungen oder verminderte Aussichten in Bezug auf die persönliche Entfaltung [6]. All diese Aspekte können zu langfristigen negativen gesundheitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen für das Kind und den betroffenen Elternteil führen. Sozioökonomische Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärken diese gesundheitlichen Ungleichheiten [8].
Multidisziplinäre Interventionen im Kontext von Kindern aus psychisch belasteten Familien (COPMI[1]) wie das VILLAGE-Projekt in Österreich [9]haben nicht nur das Potenzial, die Lebensqualität der betroffenen Kinder zu verbessern und die elterliche psychische Erkrankung besser zu verstehen. Öffentliche Investitionen in Interventionen für COPMI, die oft präventiver Natur sind, bieten auch die Möglichkeit, Ziele der öffentlichen Gesundheit und die Sicherstellung der Gesundheit in allen Politikbereichen („Health in all Policies“) miteinzubeziehen, gleichzeitig aber auch eine öffentliche Breitenwirkung zu erzeugen, die über individuelle Gesundheitsaspekte hinausgeht. Somit werden durch diese Interventionen zum einen die Chancengleichheit hinsichtlich der Gesundheit angestrebt und zum anderen können diese Interventionen zusätzliche positive Effekte für das einzelne Individuum aber auch für die Gesellschaft haben (Partizipation, Empowerment, Sicherheitsgefühl, Würde, Selbstachtung, soziale Unterstützung, Verbesserung der Hilfesuche).
Obwohl es Evidenz zu den Kosten [10]oder der Kosteneffektivität [11, 12]von familienorientierten komplexen Interventionen für COPMIs gibt, sind umfassende soziale Folgenabschätzungen selten und werden möglicherweise nur ungenügend in die aktuellen HTA-Prozesse und -Methoden einbezogen [13]. In den meisten Fällen konzentrieren sich die Analysen auf gesundheitsökonomische Evaluationen und folgen einem ressourcenorientierten mikroökonomischen Ansatz, der oft nicht in der Lage ist, den sozioökonomischen Nutzen jenseits der gesundheitlichen Outcomes oder den Nutzen und die Kosten außerhalb des Gesundheitssektors zu erfassen [13]- sogenannte intersektorale Kosten und Nutzen (ICBs[2]) [14, 15]. Gründe dafür sind Schwierigkeiten, solche Interventionen mit dem geeigneten Evaluationsinstrument zu bewerten [16, 17], aber auch, dass Entscheidungsträger in der Regel eher nach Kosten-Effektivitäts-Verhältnissen als nach breiteren wirtschaftlichen Auswirkungen fragen. Darüber hinaus erschwert die Komplexität des sozialen Systems, in dem die Interventionen wirken, die genaue Erfassung von Auswirkungen, die über kurzfristige wirtschaftliche Konsequenzen hinausgehen.
Komplexitäten dieser Art stellen die „traditionellen“ ökonomischen Bewertungsmethoden vor Schwierigkeiten [18]. Es gibt ein paar wenige Methoden zur Bewertung des gesellschaftlichen Werts einer Intervention (z. B. das Konzept des Social Return on Investment (SROI) [19]). Darüber hinaus ist die Entwicklung von neuen Standards der ökonomischen Evaluation, die Wirkungen über gesundheitsbezogene Ergebnisse hinaus oder multisektorale Wirkungen aus gesellschaftlicher Perspektive erfassen, ein laufendes Thema [13, 16, 20-23]. Obwohl diese Methoden ihre eigenen Grenzen haben, können sie nützlich sein, um die ökonomische und soziale Dimension von COPMI-relevanten Aspekten und langfristigen Opportunitätskosten zu erfassen.
Das Projekt ist in zwei Teile gegliedert.
Teil I: Systematische Literaturübersicht über die ökonomischen und sozialen Auswirkungen von familienorientierten komplexen Interventionen für Kinder aus psychisch belasteten Familien
Ziele und Forschungsfragen: Teil I soll einen (systematischen) Überblick über die Kosteneffektivität und die breiteren sozialen und ökonomischen Auswirkungen familienorientierter komplexer Interventionen geben, die sich auf Prävention oder Frühintervention im Bereich COPMI konzentrieren. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein von Gesundheitsplanern und Entscheidungsträgern für die ökonomischen Dimensionen von psychischen Gesundheitsproblemen in Familien zu schärfen. Darüber hinaus dient die Übersicht als Informationsquelle für (gesundheitsökonomische) Wissenschaftler*innen, um soziale und ökonomische Evaluationen und Wirkungsanalysen für ähnliche Interventionen wie das VILLAGE-Projekt durchzuführen.
Die folgenden Forschungsfragen (FF) werden in diesem Teil behandelt:
FF1: Welche internationale Evidenz zur Kosteneffektivität und zu den weiteren ökonomischen und sozialen Auswirkungen familienorientierter komplexer Interventionen für COPMI mit dem Fokus auf kindliche Prävention oder Frühintervention gibt es? Welche Methoden werden zur Evaluation gesundheitsökonomischer und sozialer Auswirkungen verwendet? Welche Programme, Kostenkategorien und Outcomes können identifiziert werden?
FF2: Wie ist die Qualität der identifizierten gesundheitsökonomischen Studien und inwieweit sind die Daten (Effekte, Population, Leistungen, Kosten etc.) der Studien für den österreichischen Kontext verallgemeinerbar?
FF3: Was sind die zusätzlichen Wirkungen der Intervention über die gesundheitsbezogenen Endpunkte hinaus, die mit (sozio-)ökonomischen Folgen einhergehen (z.B. Partizipation, Empowerment, Sicherheitsgefühl, Würde, Selbstachtung, soziale Unterstützung), und was sind Opportunitätskosten oder mögliche nachhaltige negative Effekte einer Unterlassung der Intervention? Welche Methoden werden angewendet, um diese Folgewirkungen zu erfassen?
Methoden: FF1 bis FF3 werden durch eine systematische Übersicht der Evidenz zu ökonomischen und sozialen Auswirkungen von international implementierten familienorientierten komplexen Interventionen mit dem Fokus auf Prävention oder „frühe“ Intervention im Bereich COPMI adressiert. Hierfür wird eine systematische Literaturrecherche in ausgewählten Datenbanken durchgeführt, um ökonomische und soziale Folgenabschätzungen zu identifizieren (EconLit, PubMed, Medline, NHS EED etc.). Die systematische Vorgehensweise wird durch eine Handsuche begleitet.
Darüber hinaus wird im Zuge der Beantwortung von FF2 die Qualität der identifizierten Studien anhand der CHEC-Checkliste [24]zur Beurteilung ökonomischer Evaluationen kritisch bewertet.
Zur Beantwortung von FF3 diskutieren wir langfristige ökonomische Auswirkungen, die potenziellen (sektorübergreifenden) ökonomischen und sozialen Auswirkungen familienorientierter komplexer Interventionen für die betroffenen Kinder sowie (gesellschaftliche) Opportunitätskosten bzw. negative Effekte aus dem Unterlassen der Intervention in einem narrativen Diskurs [25, 26]. Ein zugrundeliegendes Logic-Modell (das sich auf frühere Ergebnisse des VILLAGE-Projekts stützt) und der Leitfaden für die Bewertung komplexer Technologien aus dem INTEGRATE-HTA-Projekt [18]dienen als theoretische Grundlage, um den kausalen Pfad zu beschreiben, über den die Intervention mögliche Auswirkungen auf gesundheitliche und nicht gesundheitsbezogene Endpunkte hat. In Form einer qualitativen Evidenzsynthese (QES) werden soziale und ökonomische Auswirkungen in Bezug auf die folgenden Kategorien betrachtet: Auswirkungen auf Individuen, Auswirkungen auf Familien, Auswirkungen auf die Gemeinschaft und allgemeine gesellschaftliche Auswirkungen. Wir verzichten auf die Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse, da der Nutzen sozialer Innovationen nicht immer in monetären Größen ausgedrückt werden kann.
PICO-Analyse für die Literatursuche:
|
Population |
Psychische Erkrankungen (PE) umfassen alle psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen (F00-F99), z. B. affektive Störungen, Schizophrenie, Psychosen, mit oder ohne Substanzmissbrauch |
|
Intervention |
Familienorientierte komplexe Interventionen, die sich auf Prävention oder "frühe" Intervention bei COPMI konzentrieren, z. B.
Nicht: Psychotherapeutische Interventionen, allgemeine psychosoziale Versorgungsleistungen für Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung, psychosoziale Versorgungsleistungen für Kinder und Jugendliche, Interventionen bei perinatalen PE oder Frühinterventionen ab der Schwangerschaft bis zum Alter des Kindes von 3 Jahren |
|
Control |
|
|
Outcomes |
|
|
Studien-design(s) |
|
|
Sprache |
Englisch/Deutsch |
|
Publikations-art |
(Un)Publizierte Fachartikel und Forschungsberichte |
|
Periode |
Ab 2010 |
Teil II: Ökonomische Evaluation des 'VILLAGE-Projekts' zur Unterstützung von Kindern aus psychisch belasteten Familien: Einzelkostenanalyse (Unit Costs)
Ziele und Forschungsfragen: Teil II zielt darauf ab, Grundlagen für eine ökonomische Analyse des VILLAGE-Projekts und des darin erprobten Programms für die betroffenen Kinder und ihre Familien zu liefern. Informationen zu Methoden und Ansätzen aus Teil I dienen hierbei als Grundlage. Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung von Stückkosten für die in Anspruch genommenen Leistungen der im VILLAGE-Projekt unterstützten Kinder. Das zweite Ziel dieses Berichtteils besteht aus der Anwendung und Sammlung von Erfahrungen eines neu entwickelten paneuropäischen Tools zur Berechnung von Stückkosten – das PECUNIA Tool [22].
Die folgenden Forschungsfragen (FF) werden in diesem Teil behandelt:
FF1: Wie hoch sind die Stückkosten für die einzelnen Leistungen, die von den Kindern im VILLAGE-Projekt in Anspruch genommen wurden?
FF2: Was sind die Vorteile und Grenzen der im EU-Projekt PECUNIA entwickelten Methoden und Instrumente zur Stückkostenberechnung in Hinblick auf die Anwendung und inwieweit ist dieser Ansatz für die ökonomische Evaluation einer familienorientierten komplexen Intervention im Bereich COPMI geeignet?
Methoden: Stückkosten für Leistungen, die im Leistungsinventar (ein Fragebogen, den Kinder im VILLAGE-Projekt bei Baseline und Follow-Up ausfüllen) enthalten sind, werden durch eine Suche nach relevanten Stückkosten in bestehenden österreichischen Datenbanken (z.B. DHE Unit Cost Database, regionale Kostendaten aus Tirol) und durch die Anwendung der standardisierten Kalkulationsinstrumente aus dem PECUNIA-Projekt [22]ermittelt. Es wird eine Liste von Stückkosten erstellt. Die Anwendung des Tools wird kritisch auf die Praktikabilität im Bereich COPMI geprüft. Darüber hinaus werden die im PECUNIA-Projekt [14, 15]identifizierten Kosten-Nutzen-Kategorien und ICBs sowie die in Teil I identifizierten gesundheitsbezogenen und nicht-gesundheitsbezogenen Auswirkungen gegenübergestellt. Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Widersprüche werden narrativ diskutiert.
Zeitplan und Meilensteine:
|
Time period |
Task |
|
April |
Scoping, Projektprotokoll |
|
Mai |
Weitere Orientierung/Scoping und erste Handsuche, Systematische Literatursuche und -auswahl, Weitere Handsuche |
|
Ende Mai – Juni |
Kategorisierung der Literatur, Datenextraktion, Bewertung der Studien |
|
Juni – Juli |
Analyse des ökonomischen und sozialen „Impact“ |
|
Juli |
Einzelkostenabfrage und Anwendbarkeitsstudie der PECUNIA Stückkostenwerkzeuge |
|
Juni – Ende August |
Berichterstellung |
|
September |
Interne und externe Begutachtung, Finalisierung |
References:
[1] United Nations Children’s Fund (UNICEF). Convention on the Rights of the Child text. 2021 [cited 14/04/2021]. Available from: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text.
[2] Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK),. Gesundheitsziele Österreich. 2021 [cited 14/04/2021]. Available from: https://gesundheitsziele-oesterreich.at/website2017/wp-content/uploads/2018/08/gz_langfassung_2018.pdf.
[3] D. Maybery and A. E. Reupert. The number of parents who are patients attending adult psychiatric services. Curr Opin Psychiatry. 2018;31(4):358-362. Epub 2018/05/31. DOI: 10.1097/yco.0000000000000427.
[4] M. Östman and L. Hansson. Children in families with a severely mentally ill member. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2002;37(5):243-248. DOI: 10.1007/s00127-002-0540-0.
[5] M. Pretis and A. Dimova. Vulnerable children of mentally ill parents: towards evidence-based support for improving resilience. Support for Learning. 2008;23(3):152-159. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9604.2008.00386.x.
[6] A. Radicke, C. Barkmann, B. Adema, A. Daubmann, K. Wegscheider and S. Wiegand-Grefe. Children of Parents with a Mental Illness: Predictors of Health-Related Quality of Life and Determinants of Child-Parent Agreement. International journal of environmental research and public health. 2021;18(2):379. DOI: 10.3390/ijerph18020379.
[7] A. Nevriana, M. Pierce, C. Dalman, S. Wicks, M. Hasselberg, H. Hope, et al. Association between maternal and paternal mental illness and risk of injuries in children and adolescents: nationwide register based cohort study in Sweden. BMJ. 2020;369:m853. DOI: 10.1136/bmj.m853.
[8] A. Freeman, S. Tyrovolas, A. Koyanagi, S. Chatterji, M. Leonardi, J. L. Ayuso-Mateos, et al. The role of socio-economic status in depression: results from the COURAGE (aging survey in Europe). BMC Public Health. 2016;16(1):1098. DOI: 10.1186/s12889-016-3638-0.
[9] H. Christiansen, A. Bauer, B. Fatima, M. Goodyear, I. O. Lund, I. Zechmeister-Koss, et al. Improving Identification and Child-Focused Collaborative Care for Children of Parents With a Mental Illness in Tyrol, Austria. Frontiers in Psychiatry. 2019;10(233). DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00233.
[10] T. Waldmann, M. Stiawa, Ü. Dinc, G. Saglam, M. Busmann, A. Daubmann, et al. Costs of health and social services use in children of parents with mental illness. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2021;15(1):10. DOI: 10.1186/s13034-021-00360-y.
[11] P. Bee, P. Bower, S. Byford, R. Churchill, R. Calam, P. Stallard, et al. The clinical effectiveness, cost-effectiveness and acceptability of community-based interventions aimed at improving or maintaining quality of life in children of parents with serious mental illness: a systematic review. Health Technol Assess. 2014;18(8):1-250. Epub 2014/02/08. DOI: 10.3310/hta18080.
[12] H. J. Wansink, R. M. W. A. Drost, A. T. G. Paulus, D. Ruwaard, C. M. H. Hosman, J. M. A. M. Janssens, et al. Cost-effectiveness of preventive case management for parents with a mental illness: a randomized controlled trial from three economic perspectives. BMC health services research. 2016;16:228-228. DOI: 10.1186/s12913-016-1498-z.
[13] K. B. Lysdahl, K. Mozygemba, J. Burns, J. B. Brönneke, J. B. Chilcott, S. Ward, et al. Comprehensive assessment of complex technologies: Integrating various aspects in Health Technology Assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2017;33(5):570-576. Epub 2017/08/07. DOI: 10.1017/S0266462317000678.
[14] L. M. M. Janssen, I. Pokhilenko, S. M. A. A. Evers, A. T. G. Paulus, J. Simon, H.-H. König, et al. Exploring the identification, validation, and categorization of the cost and benefits of criminal justice in mental health: the PECUNIA project. Int J Technol Assess Health Care. 2020;36(4):418-425. Epub 2020/07/27. DOI: 10.1017/S0266462320000471.
[15] I. Pokhilenko, L. M. M. Janssen, S. M. A. A. Evers, R. M. W. A. Drost, J. Simon, H.-H. König, et al. Exploring the identification, validation, and categorization of costs and benefits of education in mental health: The PECUNIA project. Int J Technol Assess Health Care. 2020;36(4):325-331. Epub 2020/05/28. DOI: 10.1017/S0266462320000203.
[16] S. Evers and C. Dircksen. Towards standardization of economic evaluation research in the youth psychosocial care sector: A broad consultation in the Netherlands. Global & Regional Health Technology Assessment. 2020;7:117-123. DOI: 10.33393/grhta.2020.2143.
[17] A. Shiell, P. Hawe and L. Gold. Complex interventions or complex systems? Implications for health economic evaluation. BMJ. 2008;336(7656):1281-1283. DOI: 10.1136/bmj.39569.510521.AD.
[18] K. Lysdahl, K. Mozygemba, J. Burns, J. Chilcott, J. Brönneke and B. Hofmann. Guidance for assessing effectiveness, economic aspects, ethical aspects, socio-cultural aspects and legal aspects in complex technologies2016.
[19] S. Fischer and M. Stanak. Social return on investment: outcomes, methods, and economic parameters. LBI-HTA Project report No. 95b, 2017. Available from: https://eprints.aihta.at/1141/.
[20] R. M. W. A. Drost, A. T. G. Paulus and S. M. A. A. Evers. Five pillars for societal perspective. Int J Technol Assess Health Care. 2020;36(2):72-74. Epub 2020/01/31. DOI: 10.1017/S026646232000001X.
[21] R. M. W. A. Drost, I. M. van der Putten, D. Ruwaard, S. M. A. A. Evers and A. T. G. Paulus. Conceptuatlizations of the societal perspective withing economic evaluations: A systematic review. Int J Technol Assess Health Care. 2017;33(2):251-260. Epub 2017/06/23. DOI: 10.1017/S0266462317000526.
[22] PECUNIA. Programme in costing, resource use measurement and outcome valuation for use in multi-sectoral national and international health economic evaluation (PECUNIA). 2021 [cited 26/04/2021]. Available from: https://www.pecunia-project.eu.
[23] J. A. Duevel, L. Hasemann, L. M. Peña-Longobardo, B. Rodríguez-Sánchez, I. Aranda-Reneo, J. Oliva-Moreno, et al. Considering the societal perspective in economic evaluations: a systematic review in the case of depression. Health Economics Review. 2020;10(1):32. DOI: 10.1186/s13561-020-00288-7.
[24] S. Evers, M. Goossens, H. de Vet, M. van Tulder and A. Ament. Criteria list for assessment of methodological quality of economic evaluations: Consensus on Health Economic Criteria. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(2):240-245. Epub 2005/06/01.
[25] M. Archer, R. Bhaskar, A. Collier, T. Lawson and A. Norrie. Critical Realism : Essential Readings. Hoboken: Routledge; 2013.
[26] R. Pawson and N. Tilley. Realistic evaluation. Repr.. ed. London [u.a.]: Sage; 2001. XVII, 235 S., graph. Darst. p.