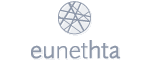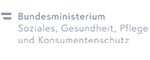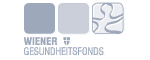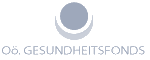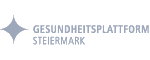Preisbildung und Arzneimittelerstattung im stationären Sektor in Österreich: Ansätze für einen transparenten und evidenzbasierten Prozess unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen

Projektleitung: Sarah Wolf
Projektbearbeitung: Sarah Wolf, Claudia Wild
Laufzeit: Mai 2018 – November 2018
Vorgeschlagen von: Bundesländern
Sprache: Deutsch (mit englischer Zusammenfassung)
Publikation: LBI-HTA Projektbericht Nr. 109: https://eprints.aihta.at/1183
Hintergrund:
Das österreichische Gesundheitssystem ist mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Eine der größten Herausforderungen stellen die laufend steigenden Arzneimittelausgaben dar, die insbesondere auf die alternde Bevölkerung und die Einführung neuer und kostenintensiver Arzneimittel, wie beispielsweise Onkologika, zurückzuführen sind. Österreich zählt europaweit meist zu den ersten Ländern, die ein neues Onkologikum anwenden, was hohe Arzneimittelpreise zur Folge hat. Das duale Finanzierungssystem des niedergelassenen und stationären Bereichs in Österreich verstärkt die Problematik bezüglich hochpreisiger Arzneimittel, insbesondere bezüglich Spitalsmedikamenten, zusätzlich. Entscheidungen im Spitalsbereich werden weitgehend unabhängig vom niedergelassenen Bereich getroffen, für den eine Art Positivliste (Erstattungskodex/EKO) existiert. Stationäre Arzneimitteltherapien haben jedoch oftmals langfristige Auswirkungen auf Folgebehandlungen im niedergelassenen Bereich, was speziell bei hochpreisigen Medikamenten von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus sind die Prozesse bezüglich der Arzneimittelpreisbildung- und Kostenerstattung zwischen niedergelassenem und stationärem Bereich, sowie zwischen den einzelnen Krankenanstalten(-verbünden) je nach Bundesland unterschiedlich. Beides kann ungleiche Entscheidungen und folglich ungleiche Arzneimittelverfügbarkeit zwischen niedergelassenem und stationärem Bereich, sowie auch auf Krankenhausebene zwischen den einzelnen Bundesländern zur Folge haben [1].
Der Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozess im niedergelassenen Bereich wird basierend auf den Empfehlungen der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK) für ganz Österreich einheitlich durchgeführt. Die HEK berücksichtigt dabei pharmakologische, medizinisch-therapeutische und gesundheitsökonomische Gesichtspunkte [2]. Im Vergleich dazu wird die Entscheidung über Einkauf und Einsatz von Arzneimitteln im stationären Bereich durch die Arzneimittelkommissionen der regionalen Krankenanstaltenträger getroffen. Systematische Evaluationen und einheitliche methodische Evaluationsstandards werden derzeit nicht angewendet [1].
Vor diesem Hintergrund starteten Spitalsträger und Kostenträger Initiativen, einen österreichweit einheitlichen Prozess für die Preisbildung und die Arzneimittelerstattung für den Spitalssektor zu entwickeln.
Projektziele:
In einem ersten Schritt soll die IST-Situation des Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozesses, sowie die zur Anwendung kommenden Methoden der Nutzenbewertung und der pharmakoökonomischen Evaluation in Österreich beschrieben werden (stationärer Bereich und niedergelassener Bereich).
Darüber hinaus werden die Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozesse einiger Länder, die standardisierte Bewertungsmethoden für die Prozesse im stationären und/oder niedergelassenen Bereich haben (z.B. nordeuropäische Länder, wie Belgien und Niederlande, Kanada, etc.), beschrieben und vor diesem Hintergrund die Stärken und Schwächen des österreichischen Systems verglichen und analysiert.
Darauf basierend, ist das Hauptziel des Projekts, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein österreichweit einheitlicher Prozess für die Preisbildung und Arzneimittelerstattung auf Krankenhausebene aussehen könnte, der methodisch den State-of-the-Art in der Nutzen- und gesundheitsökonomischen Bewertung erfüllt und die österreichischen Rahmenbedingungen, sowie bereits existierende Prozesse (z.B. HEK) berücksichtigt. Im Vordergrund steht das Ziel, einen transparenten und evidenzbasierten Prozess zu entwickeln.
Ein spezieller Fokus sollte auf „Orphan Drugs“ („Medikamente für seltene Krankheiten“) gelegt werden, da sich die Prozesse (Preisbildung und Kostenerstattung) für „Orphan Drugs“ von den Prozessen anderer Arzneimittel unterscheiden können und zudem diese Medikamente besonders kostenintensiv sind [3].
Ziel des Projekts ist es NICHT, einen endgültigen Prozess für die Preisgestaltung und Arzneimittelerstattung im stationären Bereich darzulegen. Vielmehr sollen Szenarien für einen Bewertungsprozess für den stationären Sektor präsentiert werden.
Forschungsfragen:
- Wie ist die Heilmittelerstattung im niedergelassenen Bereich geregelt? Wie sehen die zeitlichen Abläufe aus (Medikamentenzulassung – Refundierungsentscheidung – Dauer der Entscheidung – Veröffentlichung)? Welche methodischen Schritte werden bei der Nutzenbewertung und pharmakoökonomischen Bewertung durchgeführt? Auf welchen rechtlichen Grundlagen beruht der Prozess? Worauf basiert die Refundierungsentscheidung (HTA inkludiert)? In wieweit werden Vereinbarungen zur bedingten Erstattung (z.B. Managed Entry Agreements, Risk Sharing Agreements) berücksichtigt? Was sind die Stärken und Schwächen des Prozesses?
- Wie ist die Arzneimittelerstattung im stationären Bereich geregelt? Wie sehen die zeitlichen Abläufe aus (Medikamentenzulassung – Refundierungsentscheidung – Dauer der Entscheidung – Veröffentlichung)? Auf welchen rechtlichen und methodischen Grundlagen beruht der Prozess im stationären Sektor? Worauf basiert die Refundierungsentscheidung (HTA inkludiert)? Was sind die Stärken und Schwächen des Prozesses?
- Wie sieht die Finanzierung von Arzneimitteln in anderen Ländern aus (niedergelassener und/oder stationärer Bereich)? Wie sehen die zeitlichen Abläufe aus (Medikamentenzulassung – Refundierungsentscheidung – Dauer der Entscheidung – Veröffentlichung)? Wie wird der Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozess in anderen Ländern methodisch durchgeführt (z.B. Nutzenbewertung, pharmakoökonomische Bewertung)? Auf welchen rechtlichen Grundlagen beruhen die Prozesse in anderen Ländern? Worauf basiert die Refundierungsentscheidung (HTA inkludiert)? In wieweit werden Vereinbarungen zur bedingten Erstattung (z.B. Managed Entry Agreements, Risk Sharing Agreements) berücksichtigt? Was sind die Stärken und Schwächen der Prozesse in anderen Ländern?
- Wie könnte ein österreichweit einheitlicher Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozess im Spitalsbereich aussehen, der methodisch den State-of-the Art in der Nutzen- und gesundheitsökonomischen Bewertung erfüllt und die österreichischen Rahmenbedingungen, sowie bereits existierende Prozesse (z.B. HEK) berücksichtigt? Welche Änderungen/Verbesserungen basierend auf den Erfahrungen anderer Länder sind notwendig, um einen transparenten und evidenzbasierten Prozess zu gestalten?
- Wie unterscheiden sich die Preisbildungs- und Arzneimittelerstattungsprozesse für „Orphan Drugs“ zu den Prozessen anderer Arzneimittel in Österreich und in anderen Ländern? Wie könnten diese Abweichungen in den Prozessen für den stationären Sektor berücksichtigt werden?
Methoden:
-
Literaturanalyse
- Literatursuche:
- Suchstrategie: Literatursuche
- Literaturtyp: politische Berichte, Richtlinien, Gesetztestexte, Handbücher von Ministerien/Organisationen/Institutionen, peer-reviewed Journalartikel, Poster, Präsentationen, etc.
- Suchorte: Website der Europäischen Kommission/der Ministerien/verschiedener Organisationen/Institutionen (z.B. WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies), Website von EUnetHTA, Google Scholar, Medline, etc.
- Zeitperiode der Veröffentlichung: 2008 - 2018
- Sprache: Deutsch, Englisch
- Informationssynthese:
- Detailliertheitsgrad der Information: 1. Schritt: Makro-Ebene – länderübergreifende Informationen (z.B. Übersichtsarbeiten), 2. Schritt: bei fehlender Information auf der Makroebene à Mikro- bzw. Länderebene
- Qualitative Synthese der Informationen
- Rastergestaltung: Informationen/Länder clustern
- Stärken- und Schwächenprofile
-
ExpertInnenbefragungen
- In Form von Interviews (z.B. qualitative Leitfadeninterviews bzw. ExpertInneninterviews) - wenn notwendig - abhängig von der Detailliertheit der verfügbaren Informationen aus ausgewählter Literatur, um Details in den Prozessen und Methoden zu erfahren.
- Keine exakte sozialwissenschaftliche Inhaltsanalyse
Vorgehensweise:
- Für die Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 wird nationale Literatur (und ggf. ExpertInneninterviews) herangezogen.
- Für die Beantwortung der Forschungsfrage 3 wird Literatur von anderen Ländern (und ggf. ExpertInneninterviews) herangezogen.
- Zur Beantwortung der Forschungsfrage 4 werden die Informationen der ersten drei Forschungsfragen herangezogen und miteinander kombiniert. So können beispielsweise Lösungsansätze/Verbesserungsvorschläge basierend auf den Stärken der Prozesse anderer Länder entwickelt werden.
- Für die Beantwortung der Forschungsfrage 5 wird sowohl in der österreichischen Literatur als auch in der Literatur anderer Länder ein Augenmerk auf „Orphan Drugs“ gelegt, da jene Arzneimittel in vielen Ländern oft separat behandelt werden.
Zeitplan:
|
Zeitperiode |
Leistungen |
|
April - Anfang Mai 2018 |
Scoping |
|
Mai – Mitte Juni 2018 |
Literaturrecherche, Auswahl und Beschaffung der Literatur, ggf. Kontaktierung der ExpertInnen |
|
Mitte Juni – September 2018 |
Ggf. Durchführung der Interviews, Verfassen des Berichts |
|
Oktober 2018 |
Interner und externer Review |
|
November 2018 |
Finalisierung |
Referenzen:
1. Zimmermann N, Vogler S (2009) Krankenhaus-Pharma-Bericht Österreich. Available via http://whocc.goeg.at/Literaturliste/Dokumente/CountryInformationReports/PHIS_Hospital_Pharma_AT_Report_deutsch.pdf. Cited 2018/17/04
2. Hauptverband der Sozialversicherungen Österreich (2018) Erstattungskodex - EKO. Available via http://www.hauptverband.at/cdscontent/load?contentid=10008.637165&version=1515485239. Cited 2018/16/04
3. Adkins EM, Nicholson L, Floyd D, et al. Oncology drugs for orphan indications: how are HTA processes evolving for this specific drug category? Clinicoecon Outcomes Res. 2017;9:327–42.