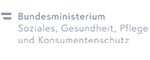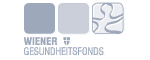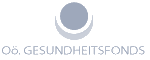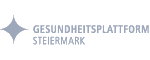Klinische Qualitätsregister in der Demenzversorgung: eine Scoping-Übersicht und Kartierung von Registern zur Verbesserung der Versorgungsqualität und Leistungserbringung

Projektleitung: Christoph Strohmaier
Projektbearbeitung: Christoph Strohmaier, Lucia Gassner
Laufzeit: April 2022 – November 2022
Sprache: Englisch mit deutscher Zusammenfassung
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 150: https://eprints.aihta.at/1419/
Hintergrund: Demenz ist ein Syndrom, das meist durch chronische oder progressive kortikale und subkortikale Neurodegeneration entsteht. Demenzerkrankungen sind durch kognitive Beeinträchtigungen, gestörte emotionale Kontrolle und eingeschränkte Fähigkeiten im täglichen Leben gekennzeichnet [1]. Die häufigsten Ursachen und Formen von Demenz sind die Alzheimer-Krankheit (AD), vaskuläre Demenzen, psychiatrische Erkrankungen und andere neurodegenerative Krankheiten, einschließlich der frontotemporalen Demenz und der Lewy-Körper-Demenz [2, 3]. Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2017 über den „Globalen Aktionsplan zur Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf Demenz“ betont, dass immer mehr Menschen direkt oder indirekt betroffen sind und dass die Komplexität dieser Erkrankung einen multiprofessionalen Public-Health-Zugang erfordert [4]. Auch in Österreich wurde 2015 die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens vom Bundesministerium für Gesundheit erkannt, was zur Beauftragung einer Demenzstrategie ("Gut leben mit Demenz") führte. Die Strategie soll Grundlagen dafür schaffen, wie Menschen mit Demenz, ihre Familien und Freunde am besten unterstützt werden können [5].
Derzeit sind die wichtigsten Säulen der Demenzversorgung die symptomatische Behandlung und die psychosoziale Betreuung der Betroffenen und der Angehörigen. In den letzten Jahren haben mehrere Länder klinische Qualitätsregister (KQR) für Demenz eingeführt, wobei die skandinavischen Länder zu den ersten gehörten, die diese Art der Register implementierten [6]. Diese Register werden als ein Instrument zur besseren Unterstützung, zum Monitoren und zur Verbesserung der Qualität der Versorgung angesehen. Der Einsatz von KQRs und die gesammelten Daten ermöglichen die Entwicklung von klinischen Qualitätsindikatoren (KQI), um die Qualität und Effizienz der Demenzversorgung zu gewährleisten, indem Unterschiede in den klinischen Prozessen und Ergebnissen erhoben werden und ein gerechter Zugang zu effektiven Dienstleistungen sichergestellt werden kann. KQR im Allgemeinen und KQI im Besonderen müssen dabei auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Erfahrungen von Patient*innen und Pflegekräften und der Sichtweise von Kliniker*innen über das gesamte Kontinuum der Versorgung von der Diagnose bis zum Lebensende beruhen. Davon profitieren nicht nur direkt von Demenz Betroffene, sondern auch die pflegenden Personen und/oder Angehörige [7].
Die Übertragbarkeit des Know-hows über KQR und den damit verbundenen Aspekten aus anderen Gesundheitssystemen auf das österreichische Gesundheitssystem sind jedoch nicht unbedingt gegeben, auch wenn Qualitätsdemenzregister als Good-Practice-Modelle wahrgenommen werden. KQR sollen Gesundheitsplaner*innen und Entscheidungsträger*innen bei ihren Bemühungen um die Entwicklung und Organisation der Demenzversorgung unterstützen. Aufgrund dessen ist der spezifische institutionelle, organisatorische/ strukturelle und epidemiologische Kontext bei der Planung und Umsetzung eines KQR wesentlich. Diese Aspekte sind von Land zu Land sehr unterschiedlich und müssen bei der Implementierung eines Registers berücksichtigt werden.
Berichtsziele: Der Bericht soll einen Überblick über bestehende und geplante KQR in der Demenzversorgung geben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Registern, die zum Monitoren von Ergebnisse und zur Verbesserung der Qualität der Demenzversorgung eingesetzt werden, und die zudem dazu beitragen, einen gerechten (gleichen) Zugang zu wirksamen Gesundheitsdienstleistungen zu gewährleisten. Das Projekt wird einen Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der identifizierten KQR in Bezug auf die derzeitige Nutzung, organisatorische, umsetzungsrelevante und technische Aspekte geben. Zu den Aspekten, die von Interesse sind, gehören z. B. die Ziele und Absichten des KQR, die betreibende Behörde oder Organisation, die Eigentümerschaft der Daten, das Setting und notwendige Personal für die Datenerhebung und -verwaltung, die notwendigen Investitionen und die erforderlichen Input-Ressourcen, die Zielpopulation oder die berücksichtigten Demenzarten, das verwendete Diagnosesystem, die Art der Daten und die Art der Zustimmung zur Datenerhebung und -verarbeitung.
Ein weiteres Hauptziel des Berichts ist es, die Daten zu ermitteln, die von den Betreiber*innen von KQR erhoben werden, wie z. B. persönliche Merkmale der Person mit Demenz, wie vorhandene Komorbiditäten, diagnostische Abklärung, Behandlungs- und Pflegedaten und andere erforderliche Input-Ressourcen (z. B. Mindestdatensatz). Darüber hinaus werden die Ergebnisse oder Informationen, die Betreiber*innen aus den gesammelten Daten ableiten, analysiert. Eine besondere Rolle spielen dabei klinische Qualitätsindikatoren (KQI) und Ergebnisparameter, die zum Monitoren und zur Bewertung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Demenzversorgung eingesetzt werden.
Des Weiteren werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf ethische, rechtliche und sozioökonomische Implikationen (ELSIs) sowie Ergebnisse aus (potentiell identifizierten) KQR-Evaluierungsberichten diskutiert werden. Der Bericht soll den Entscheidungsträgern als Grundlage für die Implementierung eines österreichweiten KQR für die Planung und Qualitätssicherung der Demenzversorgung dienen, die mit der österreichischen Demenzstrategie konsistent ist und diese komplementiert. Daher werden die Ergebnisse und Implikationen in den österreichischen Versorgungskontext eingebettet.
Nicht-Ziele:
Der Bericht…
- befasst sich nicht mit anderen Arten von Demenzregistern, wie z. B. Registern für die (präklinische) Forschung, Registern für Arzneimittel/Medizinprodukte, Registern für Forschungsfreiwillige und Registern für Krankheiten oder epidemiologische Register. Obwohl sich viele Register in Bezug auf die angegebenen Zwecke überschneiden, konzentriert sich der Bericht auf Register, die in erster Linie dem Zweck der Qualitätssicherung der Demenzversorgung dienen.
- führt keine systematische Bewertung der Wirksamkeit oder der Qualität der verschiedenen KQRs durch.
- konzipiert kein eigenständiges österreichisches KQR für Demenz, gibt keine konkreten Anleitungen für den Umsetzungsprozess und wird auch keine spezifischen KQI entwickeln.
Forschungsfragen:
Die folgenden Forschungsfragen (FF) werden im Zuge der Berichterstellung beantwortet:
- Welche implementierten oder geplanten KQR gibt es und was sind gemeinsame Merkmale (organisatorische, umsetzungsbezogene und technische Aspekte) und Unterschiede in der Nutzung solcher Register?
- Welche Daten werden im Rahmen dieser Register erhoben, und welche Indikatoren bzw. Ergebnisparameter lassen sich aus den erhobenen Daten zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Demenzversorgung ableiten?
- Welche ethischen, rechtlichen und sozioökonomischen Implikationen (ELSIs) sind vor der Implementierung eines österreichweiten KQR zu berücksichtigen?
Methoden:
FF1 und FF2: Scoping-Übersicht und Kartierung bestehender und geplanter nationaler und subnationaler KQR und Register, die für das Monitoring der Ergebnisse und die Verbesserung der Qualität der Demenzpflege verwendet werden.
- KQR identifizieren 1: Handsuche in relevanten Datenbanken (PubMed, TRIPS-Datenbank usw.), Metasuchmaschinen und Suche auf Websites von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen des Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheit (NICE, WHO usw.) nach dem vorgegebenen PICo-Schema[1].
- KQR identifizieren 2: Update bereits vorhandener (systematischer) Übersichten und Berichte über Qualitätssicherungssysteme für Demenzkranke.
- Tabellarische Erfassung organisatorischer, methodischer und umsetzungsbezogener Aspekte, tabellarische Erfassung und Analyse der erhobenen Daten und Darstellung abgeleiteter Schlussfolgerungen, wie z. B. potenzielle KQI und Ergebnisparameter, zum Monitoring und zur Bewertung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Demenzversorgung von der Diagnose bis zu den Ergebnissen.
- Narrative Synthese der gesammelten Informationen und Diskussion der Ergebnisse von FF1 und FF2.
- Gegebenenfalls Kontaktaufnahme mit Betreiber*innen von KQR.
FF3: Analytische Ausarbeitung von Implikationen aus den identifizierten KQR-Informationen für den österreichischen Kontext und die österreichische Demenzstrategie.
- Identifizierung und Diskussion relevanter ELSIs und Zusammenfassung der Ergebnisse der KQR-Evaluationsberichte.
- Narrative Einbettung in den österreichischen Kontext und die österreichische Demenzstrategie.
PICo-Analyse:
|
Population/ Problem |
Patient*innen mit Demenz gemäß ICD-10 [8]: (F00-F03) „Demenz (ICD-10-Code: F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome nach ICD über mindestens 6 Monate bestanden haben. Die Sinne (Sinnesorgane, Wahrnehmung) funktionieren im für die Person üblichen Rahmen. Gewöhnlich begleiten Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation die kognitiven Beeinträchtigungen; gelegentlich treten diese Syndrome auch eher auf. Sie kommen bei Alzheimer-Krankheit, Gefäßerkrankungen des Gehirns und anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn und die Neuronen betreffen.“ |
|
Interesse |
Der Bericht befasst sich mit Registern zur klinischen Qualität der Demenzversorgung, wobei der Schwerpunkt auf den folgenden Aspekten liegt:
Nicht-Interessen: Andere Arten von Demenzregistern und Register mit eingeschränktem lokalem Erfassungsbereich (krankenhaus- bzw. klinikbasierte Register), systematische Evaluierung/Bewertung der Wirksamkeit oder Qualität von KQRs, Konzipierung eines eigenständigen KQR für Österreich oder Entwicklung von KQI |
|
Kontext |
Länder mit gehobenem bis hohem Einkommen und einem mit Österreich |
|
Sprache |
Englisch/Deutsch oder Übersetzung von Berichten in andere Sprachen |
|
Publikationsart |
jede Art der Publikation |
|
Zeitraum |
Update früherer und bestehender systematischer Übersichten und Berichte ab 2016 |
Alle Arbeitsschritte werden nach dem 4-Augen Prinzip (CS, LG ode AP) durchgeführt und die Ergebnisse werden von internen und externen Reviewer*innen begutachtet.
Zeitplan und Meilensteine:
|
Zeitraum |
Aufgabe |
|
April – 13. Mai 2022 |
Scoping, Projektprotokoll |
|
13. Mai 2022 |
Meilenstein 1: Projektprotokoll hochladen/Start des Projekts |
|
13. Mai – 30. Juni 2022 |
Meilenstein 2: Relevante Literatur zu KQR wird/ist ermittelt
|
|
30. Juni – 31. Juli 2022 |
Bearbeitung der FF1 und FF2 – Scoping-Übersicht und Kartierung von KQR
|
|
31. Juli – 1. Oktober 2022 |
Bearbeitung der FF3 – Lokalisierung der identifizierten Evidenz zu KQR im österreichischen Demenzkontext
österreichische Demenzstrategie |
|
1. – 10. Oktober 2022 |
Meilenstein 3: Fließtext wird verfasst und Zusammenfassung aller Berichtsteile |
|
10. – 14. Oktober 2022 |
Finalisierung |
|
14. Oktober 2022 |
Interne Begutachtung |
|
19. Oktober 2022 |
Externe Begutachtung |
|
4. November 2022 |
Meilenstein 4: Qualitätssicherung ist abgeschlossen |
|
10. November 2022 |
Layout |
|
14 November 2022 |
Meilenstein 5: Bericht ist auf der AIHTA-Webseite veröffentlicht |
Referenzen:
[1] Lücke C. and Rüther L. Demenz. Pschyrembel online: 2022 [cited 26/04/2022]. Available from: https://www.pschyrembel.de/demenz/K05MH/doc/.
[2] Heim T. M. Alzheimer-Demenz. Deximed - Hausarztwissen online: 2021 [cited 26/04/2022]. Available from: https://deximed.de/home/klinische-themen/geriatrie/krankheiten/demenzerkrankungen/alzheimer-demenz#.
[3] Press D. and Alexander M. Prevention of dementia. UpToDate: 2020 [cited 26/04/2022]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-dementia?search=dementia&source=search_result&selectedTitle=19~150&usage_type=default&display_rank=19
[4] World Health Organisation (WHO). Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025. Geneva: World Health Organisation, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO: 2017 [cited 15/04/2022]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-2017---2025.
[5] Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). Dementia strategy - Living well with dementia. 2015 [cited 15/04/2022]. Available from: https://www.demenzstrategie.at/fxdata/demenzstrategie/prod/media/Demenzstrategie_Neu_englisch.pdf.
[6] Krysinska K., Sachdev P. S., Breitner J., Kivipelto M., Kukull W. and Brodaty H. Dementia registries around the globe and their applications: A systematic review. Alzheimers Dement. 2017;13(9):1031-1047. Epub 2017/06/04. DOI: 10.1016/j.jalz.2017.04.005.
[7] Ayton D., Gardam M., Ward S., Brodaty H., Pritchard E., Earnest A., et al. How Can Quality of Dementia Care Be Measured? The Development of Clinical Quality Indicators for an Australian Pilot Dementia Registry. J Alzheimers Dis. 2020;75(3):923-936. Epub 2020/05/12. DOI: 10.3233/jad-191044.
[8] World Health Organisation (WHO). ICD-10 Version: 2019. 2019 [cited 17/04/2022]. Available from: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F00.
[1] Ein Schema/eine Analyse nach Population (P), Interesse (I) und Kontext (Co) ist in der qualitativen Evidenzsynthese verbreiteter und für diesen Bericht besser geeignet als eine PICO-Analyse, die in quantitativen Evidenzsynthesen verwendet wird.