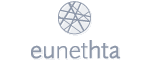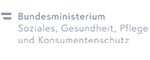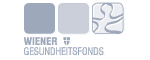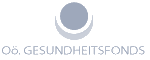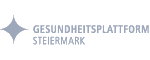Schwellenwerte in gesundheitsökonomischen Evaluationen und Erstattungsentscheidungen

Projektleitung: Christoph Strohmaier
Projektbearbeitung: Christoph Strohmaier
Qualitätssicherung: Ingrid Zechmeister-Koss
Zeitraum: März bis September 2024
Sprache: Englisch (mit Deutscher Zusammenfassung)
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 163: https://eprints.aihta.at/1549/
Hintergrund:
In vielen Ländern ist Health Technology Assessment (HTA) integraler Bestandteil von Erstattungsentscheidungen und Finanzierungsempfehlungen [1, 2]. Neben der Bewertung der Wirksamkeit und anderer (z.B. ethischer, organisatorischer, sozialer) Aspekte ist die gesundheitsökonomische Evaluation (ökon. Eval.) ein wichtiger Bestandteil von HTA-Berichten. Dennoch wird eine "lehrbuchmäßige" ökon. Eval. nicht in allen Ländern, die HTA zur Entscheidungsfindung nutzen, durchgeführt. Ökon. Eval., wie z. B. Kosten-Effektivitäts-Analysen (CEA), zielen darauf ab, Entscheidungsträger über die optimale Ressourcenverteilung im Gesundheitssystem zu informieren. Vereinfacht ausgedrückt soll die Frage beantwortet werden, ob die Intervention ihre Kosten „wert“ ist [3, 4]. Ökon. Eval. liefern in Bezug auf Effizienz beim Vergleich zweier Interventionen nur dann aussagekräftige Ergebnisse, wenn das inkrementelle Kosten-Effektivität-Verhältnis[1] (ICER), das sind die zusätzlichen Kosten pro zusätzlich gewonnener Einheit Gesundheitseffekt, mit einem Referenzwert bzw. Schwellenwert[2] verglichen wird. Während ökon. Eval. in Kombination mit ICER-Schwellenwerten Entscheidungen unterstützen können, weist deren Anwendung in Erstattungsprozessen mehrere Limitationen auf. Zum einen gibt es keinen universellen ICER-Schwellenwert und zum anderen existieren unterschiedliche Methoden zur Ableitung von Schwellenwerten [5-8]. Jeder dieser Ansätze hat jedoch seine methodischen Schwächen. Nur sehr wenige Länder haben einen expliziten Schwellenwert [1, 4, 9]. Selbst Länder mit expliziten Schwellenwerten, wie das Vereinigte Königreich mit dem National Health Service (NHS), verwenden für ihre Finanzierungsentscheidungen eine Schwellenwertspanne [10].
Abgesehen davon, dass keine universellen Schwellenwerte existieren, basiert der ICER-Schwellenwert auf einigen starken methodischen Annahmen. Diese Annahmen beruhen auf der neoklassischen (extra-)welfaristischen Theorie. Eine ökon. Eval. gibt nur Auskunft über die optimale Nutzung der Ressourcen im ökonomischen Sinne, d.h. ob die Ressourcen im Kontext eines politisch festgelegten Budgets effizient genutzt werden. Die Maximierung der Gesundheit ist allerdings nicht das einzige Ziel von Entscheidungsträgern und Politiker*innen. Zudem ist eine effiziente Ressourcennutzung nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit dem Konzept „Best-Value-for-Money“ (bestes Preis-Leistungs-Verhältnis), Wirtschaftlichkeit oder der Leistbarkeit [11]. Entscheidungsträger und Politiker*innen berücksichtigen bei ihren politischen Entscheidungen auch Gerechtigkeitsaspekte, den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen oder andere soziale Präferenzen. Diese Faktoren – so genannte Modifikatoren – werden in der Regel in einer klassischen ökon. Eval. nicht explizit und vor allem nicht durch den ICER-Schwellenwert berücksichtigt. Daher benutzen einige Länder qualitative Modifikatoren oder erweitern ihre ökon. Eval. um quantitative oder qualitative Modifikatoren [1]. Diese für die Entscheidungsfindung relevanten Modifikatoren variieren von Gesundheitssystem zu Gesundheitssystem. Modifikatoren in verschiedenen Ländern umfassen beispielsweise die Schwere der Krankheit (Krankheitslast, Krankheitskategorie, Lebensende), die Seltenheit der Krankheit („Orphan Disease“), die Gerechtigkeit und Gleichheit des Zugangs zur Gesundheitsversorgung oder die Verfügbarkeit von Alternativen [1]. Auch wenn explizite Schwellenwerte Transparenz und eine gewisse Konsistenz im Entscheidungsprozess gewährleisten, müssen die Schwächen, die mit der Anwendung des ICER-Konzepts und den damit verbundenen Schwellenwerten in Entscheidungsprozessen einhergehen, berücksichtigt werden.
In einigen Ländern wird die ökon. Eval. aufgrund dieser Limitationen und der geringeren Priorität eines effizienten Ressourceneinsatzes nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen. Wiederum einige Länder verwenden zwar ökon. Eval., haben aber keine expliziten Schwellenwerte, und weitere Länder gewichten andere Faktoren im Entscheidungsprozess höher als ICER-Schwellenwerte [1]. In Österreich spielt die ökon. Eval. bei Erstattungsentscheidungen eine untergeordnete Rolle. Ein ICER-Schwellenwert wurde bisher weder definiert noch diskutiert [12]. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen bei der Erreichung eines nachhaltigen öffentlichen Gesundheitssystems und der Einführung von Schwellenwerten in vielen europäischen Ländern ist es jedoch auch für Österreich entscheidend, das Konzept der Schwellenwerte im Kontext des österreichischen Gesundheitssystems zu verstehen und die Vorteile und Grenzen von Schwellenwerten zu analysieren.
Ziele:
Das Projekt zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen, den Zweck und die Implikationen der in der Gesundheitsökonomie verwendeten ICER-Schwellenwerte zu erklären. Um diese Ziele zu erreichen, sind eine kritische Überprüfung wichtiger gesundheitsökonomischer Konzepte und eine Diskussion der Implikationen für die Entscheidungsfindung erforderlich.
Darüber hinaus soll das Projekt einen Überblick über die Länder geben, die ökon. Eval. mit zugehörigen ICER-Schwellenwerten als Teil von Erstattungsentscheidungen und Finanzierungsempfehlungen verwenden. Im Rahmen des Projekts werden wir gesellschaftliche Präferenzen („Values“) und weitere Faktoren (Modifikatoren) identifizieren, die anstelle von oder zusätzlich zu expliziten ICER-Schwellenwerten in ökon. Eval. und im Entscheidungsprozess verwendet werden. Wir werden die zugrundeliegenden Methoden, gesellschaftlichen Präferenzen und Begründungen ermitteln, die die Unterschiede bei den Schwellenwerten und Modifikatoren in den verschiedenen Ländern und Gesundheitssystemen bestimmen.
In einem letzten Schritt werden die Ergebnisse in den Kontext des österreichischen Gesundheitssystems eingebettet, um das Verständnis dafür zu verbessern, was die Einführung eines Schwellenwertes für die Entscheidungsprozesse bedeuten würde.
Nicht-Ziele:
Der Bericht führt keine Bewertung des österreichischen Rechtsrahmens bezüglich ökon. Eval. und der Konsequenzen der Anwendung von ICER-Schwellenwerten oder anderen Entscheidungsfaktoren (Modifikatoren) im Entscheidungsprozess in Form eines Rechtsgutachtens durch.
Forschungsfragen:
Der Bericht adressiert die folgenden Forschungsfragen (FF) :
FF1: Was sind die theoretischen Grundlagen und Auswirkungen von ICER-Schwellenwerten und ihre Bedeutung für den Entscheidungsprozess?
FF2: Was sind mögliche Methoden zur Festlegung von Schwellenwerten sowie deren Vorteile und Grenzen?
FF3: Welche Länder verwenden ICER-Schwellenwerte, und welche anderen Faktoren spielen bei der ökon. Eval. in HTA-Berichten und bei der Entscheidungsfindung eine wesentliche Rolle? Welche Auswirkungen haben Schwellenwerte (z. B. Transparenz der Verfahren, Zugang zur Behandlung, Preise, gesundheitliche Gleichstellung)?
FF4: Was würde die Einführung eines Schwellenwertes für den Kontext des österreichischen Gesundheitssystems bedeuten (z.B. Gesetze und bestehende Entscheidungsprozesse, die von der Anwendung von Schwellenwerten in Österreich betroffen wären)?
Methoden:
FF1: Theoretische Grundlagen, Zweck und Auswirkungen von ICER-Schwellenwerten und Modifikatoren in ökon. Eval. und HTAs:
- Überblick der grundlegenden Konzepte, Definitionen und die kritische Reflexion ökon. Eval. auf der Grundlage der einschlägigen Literatur (Lehrbücher und Methodenpapiere). Die relevante Literatur wird auf der Grundlage des Wissens der Autor*innen identifiziert und durch eine Schneeballsystemstrategie unterstützt.
- Kritische Diskussion über die Methodik und Logik von ökon. Eval. und die Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung.
FF2: Methoden zur Festlegung von Schwellenwerten:
- Literaturrecherche zu den Methoden und Klassifizierung nach den Kategorien, die während des Analyseprozesses ermittelt wurden.
FF3: Überblick über die Länder, die ökon. Eval. mit Schwellenwerten und/oder Modifikatoren verwenden:
-
Identifizierung von Ländern, die ökon. Eval. mit Schwellenwerten und/oder Modifikatoren verwenden, sowie relevante Informationen über Schwellenwerte auf der Grundlage der folgenden Quellen:
- ISPOR Überblick über pharmako-ökonomische Leitlinien (https://www.ispor.org/heor-resources/more-heor-resources/pharmacoeconomic-guidelines/pe-guideline-detail).
- Vorhandene Berichte über internationale Schwellenwerte [1, 9].
- Bei unzureichenden oder fehlenden Informationen werden Expert*innen des jeweiligen Landes hinzugezogen.
- Tabellarische Aufstellung der ermittelten Länder, ihrer ICER-Schwellenwerte und Modifikatoren.
- Narrative Synthese und Analyse der gesammelten Informationen.
FF4: Faktoren hinsichtlich der Umsetzung von Schwellenwerten in Österreich:
- Strukturierte Handsuche nach entscheidungsrelevanten Dokumenten wie Gesetzestexten oder Systembeschreibungen.
- Gegenüberstellung der Erkenntnisse aus FF1-3 mit dem österreichischen Gesundheitssystemkontext (Identifizierung von Vor- und Nachteilen und Implementierungsanforderungen).
PICo analysis:
|
Problem |
In Österreich spielen gesundheitsökonomische Evaluationen (ökon. Eval.) bei Erstattungsentscheidungen eine untergeordnete Rolle und ein ICER-Schwellenwert wurde bisher weder definiert noch diskutiert. Es gibt derzeit einen Mangel an Wissen über die Vorteile von ökon. Eval. und die methodischen Herausforderungen und Schwächen von ICER-Schwellenwerten bei der Entscheidungsfindung im österreichischen Kontext. Entscheidungsträger*innen und Politiker*innen benötigen eine methodische Übersicht, wenn sie Entscheidungen über die Kriterien treffen, die für Erstattungs- oder Finanzierungsentscheidungen verwendet werden sollen. |
|
Interesse |
FF1 und FF2: Überblick der theoretischen Grundlagen, des Zwecks und der Auswirkungen von ICER-Schwellenwerten und Modifikatoren in ökon. Eval. und HTA-Berichten. Methoden zur Ableitung von ICER-Schwellenwerten werden erarbeitet und die ermittelten Informationen werden kritisch diskutiert. RQ3: Umgang mit und Bedeutung von Schwellenwerten und Modifikatoren in anderen Ländern RQ4: Verständnis für das Für und Wider von Schwellenwerten im Kontext des österreichischen Gesundheitswesens und der Umsetzungserfordernisse (gesetzliche Regelungen, Notwendigkeit eines Rechtsgutachtens bzw. einer Gesetzesfolgenabschätzung, methodisches Vorgehen bei der Ableitung von Schwellenwerten, Einbindung von Forscher*innen, allgemeine Umsetzungsaspekte, etc.) Nicht-Interesse: Rechtliche Analyse im Sinne eines Rechtsgutachtens. |
|
Kontext |
Internationaler Kontext mit Schwerpunkt auf Gesundheitssysteme europäischer Länder und Ländern mit Ähnlichkeiten im Gesundheitssystem. |
|
Sprache |
Englisch/Deutsch |
|
Art der Publikation |
Alle Arten von Publikationen |
Abkürzungen: ökon. Eval.…gesundheitsökonomische Evaluation, ICER…incremental cost-effectiveness ratio/inkrementelles Kosten-Effektivitäts-Verhältnis, PIKo…Problem, Interests, Kontext
Die Qualität des Berichts wird durch interne und externe Begutachter*innen sichergestellt.
Referenzen:
[1] Kyann Z. and Martina G. International Cost-Effectiveness Thresholds and Modifiers for HTA Decision Making. Office of Health Economics, 2020 May. [cited 22/2/2024]. Available from: https://ideas.repec.org/p/ohe/conres/002271.html.
[2] Garcia-Mochon L., Espin Balbino J., Olry de Labry Lima A., Caro Martinez A., Martin Ruiz E. and Perez Velasco R. HTA and decision-making processes in Central, Eastern and South Eastern Europe: Results from a survey. Health Policy. 2019;123(2):182-190. Epub 20170331. DOI: 10.1016/j.healthpol.2017.03.010.
[3] Drummond M. F., Sculpher M. J., Claxton K., Stoddart G. L. and Torrance G. W. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford: Oxford University Press; 2015.
[4] Cleemput I., Neyt M., Thiry N., De Laet C. and Leys M. Using threshold values for cost per quality-adjusted life-year gained in healthcare decisions. Int J Technol Assess Health Care. 2011;27(1):71-76. Epub 20110125. DOI: 10.1017/S0266462310001194.
[5] Santos A. S., Guerra-Junior A. A., Godman B., Morton A. and Ruas C. M. Cost-effectiveness thresholds: methods for setting and examples from around the world. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2018;18(3):277-288. Epub 20180227. DOI: 10.1080/14737167.2018.1443810.
[6] Pichon-Riviere A., Drummond M., Palacios A., Garcia-Marti S. and Augustovski F. Determining the efficiency path to universal health coverage: cost-effectiveness thresholds for 174 countries based on growth in life expectancy and health expenditures. Lancet Glob Health. 2023;11(6):e833-e842. DOI: 10.1016/S2214-109X(23)00162-6.
[7] Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Allgemeine Methoden Version 7.0. 2023 [cited 21/02/2024]. Available from: https://www.iqwig.de/methoden/allgemeine-methoden_version-7-0.pdf.
[8] Sampson C., Zamora B., Watson S., Cairns J., Chalkidou K., Cubi-Molla P., et al. Supply-Side Cost-Effectiveness Thresholds: Questions for Evidence-Based Policy. Appl Health Econ Health Policy. 2022;20(5):651-667. Epub 20220607. DOI: 10.1007/s40258-022-00730-3.
[9] Cleemput I., Neyt M., Thiry N., De Laet C. and Leys M. Threshold values for cost-effectiveness in health care. Health Technology Assessment (HTA). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), 2008.
[10] McCabe C., Claxton K. and Culyer A. J. The NICE cost-effectiveness threshold: what it is and what that means. PharmacoEconomics. 2008;26(9):733-744. DOI: 10.2165/00019053-200826090-00004.
[11] Pearson S. D. The ICER Value Framework: Integrating Cost Effectiveness and Affordability in the Assessment of Health Care Value. Value Health. 2018;21(3):258-265. DOI: 10.1016/j.jval.2017.12.017.
[12] Zechmeister-Koss I., Stanak M. and Wolf S. The status of health economic evaluation within decision making in Austria. Wien Med Wochenschr. 2019;169(11-12):271-283. Epub 20190312. Stand der gesundheitsokonomischen Evaluation bei der Entscheidungsfindung in Osterreich. DOI: 10.1007/s10354-019-0689-8.
[1] Das Ergebnis dieses Vergleichs wird als inkrementelles Kosten-Nutzen-Verhältnis (ICER) bezeichnet. Dieses Verhältnis ist ein Kosten-Effektivitätsmaß einer Intervention im Vergleich zu einer Alternative (Komparator).
[2] "Der Kosten-Effektivitäts-Schwellenwert ist der maximale (Geld-)Betrag, den ein Entscheidungsträger bereit ist, für eine Einheit des Gesundheitsergebnisses zu zahlen. Wenn die Kosteneffektivität (ICER) einer neuen Therapie (im Vergleich zu einer relevanten Alternative) als unter dem Schwellenwert liegend eingeschätzt wird, ist es (bei ansonsten gleichen Bedingungen) wahrscheinlich, dass der Entscheidungsträger die neue Therapie empfehlen wird." (Übersetzung von https://yhec.co.uk/glossary/cost-effectiveness-threshold/)