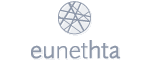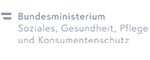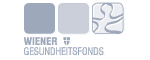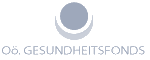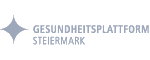Behandlung durch klinische PsychologInnen; Literaturübersicht zu Ausbildung, Behandlungsmethoden und Anwendungsbereichen

Projektleitung: Claudia Wild
Laufzeit: April 2013 – September 2013
Publikationen:
LBI-HTA Projektbericht Nr. 69a: https://eprints.aihta.at/1018
Kontakt: Nikolaus Patera
LBI-HTA Projektbericht Nr. 69b: https://eprints.aihta.at/1019
Kontakt: Inanna Reinsperger
Sprache: Deutsch
Hintergrund und Ziel:
Klinische Psychologie wird in einem Lehrbuch als „diejenige Teildisziplin der Psychologie“ definiert, „die sich mit psychischen Störungen und den psychischen Aspekten somatischer Störungen/Krankheiten befasst. Dazu gehören u.a. die Themen Ätiologie/Bedingungsanalyse, Klassifikation, Diagnostik, Epidemiologie, Intervention (Prävention, Psychotherapie, Rehabilitation, Gesundheitsversorgung, Evaluation)“.1
In Österreich ist derzeit die klinisch-psychologische Diagnostik im ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) verankert, nicht jedoch die klinisch-psychologische Behandlung. Entsprechend dem Entschließungsantrag des Nationalrats vom 8. Juli 2011 soll die Möglichkeit der Aufnahme klinisch-psychologischer Behandlung in die Sozialversicherungsgesetze geprüft werden. Vor der Beurteilung der möglichen Verankerung klinisch-psychologischer Behandlung in der Sozialversicherung wäre zu klären, was im Bereich der klinisch-psychologischen Behandlung geleistet werden könnte.
Projektziel:
Ziel des Projektberichts ist es daher, anhand der unten genannten Forschungsfragen eine systematische Übersicht zur klinisch-psychologischen Behandlung zu erarbeiten.
Forschungsfragen:
• Was verstehen internationale Standards unter „klinisch-psychologischer Behandlung"?
• Für welche Diagnosen stehen wissenschaftlich gesichert wirksame klinisch-psychologische Behandlungsmethoden zur Verfügung und inwieweit handelt es sich bei den betreffenden Diagnosen um krankheitswertige Störungen, für die eine Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung vorstellbar ist?
• Wie könnte eine Kompetenzverteilung bzw. Grenzziehung zwischen den Berufsgruppen der PsychotherapeutInnen einerseits sowie der klinischen Psychologlnnen andererseits aussehen, um von vornherein ineffiziente Doppelgleisigkeiten in der Versorgung zu vermeiden?
• Lassen sich der klinisch-psychologischen Behandlung spezifische Einsatzgebiete bzw. typische Arbeitsfelder, wie etwa bei chronischen, kardiologischen, dementiellen und psychoonkologischen Erkrankungen, bei Stoffwechselerkrankungen, bei Kindern und Jugendlichen, bei Neuropsychologie und Neurorehabilitation in Bezug auf Schlaganfälle, Arbeitsunfälle etc. zuordnen?
• Können insbesondere zu den beschriebenen Bereichen, aber auch darüber hinaus spezifische Störungsbilder, Zielsetzungen der diagnostischen Abklärung, diagnostische Verfahren, Zielsetzungen der klinisch-psychologischen Behandlung, Behandlungsprogramme und lnterventionstechniken, Dauer der Behandlung und Frequenz, Literatur für Betroffene in Form eines „Leistungskatalogs klinisch-psychologischer Interventionen" etwa tabellarisch dargestellt werden?
• Ist bereits gesichert, dass jede/r klinische Psychologe/in tatsächlich zur wirksamen und effizienten (alleinigen) Behandlung der im Rahmen der obigen Fragestellungen geklärten Kompetenzen befähigt ist?
• Reichen die derzeitigen generellen Ausbildungsvoraussetzungen in klinischer Psychologie aus, um eine ausreichende Qualitätssicherung für die ,,klinisch-psychologische Krankenbehandlung" zu bieten?
• Gibt es (nationale wie auch internationale) Forschungsarbeiten oder Tätigkeiten von klinischen PsychologInnen, die seit vielen Jahren im intramuralen Bereich arbeiten, aus denen sich Erkenntnisse im Zusammenhang mit den oben genannten Fragen gewinnen lassen?
Methoden:
Systematische Suche nach und Gegenüberstellung von
• nationalen und internationalen Definitionen (Behandlungsmethoden, Aufgabenbereiche, Rolle im interdisziplinären Behandlungskanon aus PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und anderen GesundheitsleistungsanbieterInnen)
• Ausbildungsnotwendigkeiten (Inhalte, Behandlungsmethoden, Tiefe und Dauer) und Ausbildungssettings (universitär/außeruniversitär, gradual/postgradual)
• Standards und Maßnahmen der Qualitätssicherung
Dabei werden auch die folgenden Perspektiven einbezogen
• Berufsverbände (PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen, …)
• Refundierungsinstitutionen
Systematische Suche und (unsystematische) grobe Auswertung von Publikationen/ Evidenz mit Fokus auf Übersichtsarbeiten und vorliegende Health Technology Assessments
• nach großen Indikationsfeldern
• nach erwartbaren Endpunkten
Weiters sollen auch Informationen aus Lehrbüchern einbezogen werden.z.B.:1,2
Systematische Analyse der
• Leistungskataloge sofern zugänglich (Deutschland, Schweiz, ev. weitere)
• Ausbildungs-Curricula (Inhalte, Behandlungsmethoden, Tiefe und Dauer) mit Bezugnahme auf Diagnosegruppen, Indikationsbereiche
• Berufsangebote durch LeistungserbringerInnen (PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen)
NICHT Inhalt des Projekts ist
• die ökonomische Bewertung der Leistungen durch die Berufsgruppe der klinischen PsychologInnen (auch im Vergleich zu Leistungen anderer Berufsgruppen) oder eine Budget-Impact-Analyse einer möglichen Ausweitung oder Beschränkung von Angeboten auf Indikationsgruppen
• die Erarbeitung eines detaillierten evidenz-basiert wissenschaftlich aufgearbeiteten Leistungskatalogs
• die Erstellung systematischer Evidenzanalysen zu einzelnen Indikationen
Zeitplan/ Meilensteine:
April 2013: Erstellen des Projektprotokolls
Mai 2013: systematische Literaturrecherche, Handsuche, Literaturauswahl
Juni – August 2013: Datenextraktion, Berichterstellung
September 2013: interner und externer Review, Publikation
Referenzen:
1 Perrez M, Baumann U. Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie. Bern: Verlag Hans Huber; 4. aktualisierte Auflage 2011.
2 Sturmey P, Hersen M (eds.). Handbook of evidence-based practice in clinical psychology. Volume One (Child and Adolescent Disorders) & Volume Two (Adult Disorders). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc; 2012