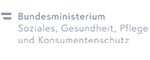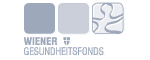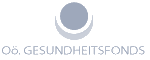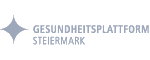Inhaltliche Weiterentwicklung Vorsorgeuntersuchung

Projektleitung: Jule Anna Pleyer, Doris Giess
Projektbearbeitung: Jule Anna Pleyer, Lena Grabenhofer, Viktoria Hofer, Doris Giess, Julia Mayer-Ferbas
Teil 1:
Laufzeit: Mitte April 2025 – Mitte November 2025 (7 PM)
Sprache: Englisch (mit deutscher Zusammenfassung)
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 170a: https://eprints.aihta.at/1576/
Teil 2:
Laufzeit: Mai 2025 – August 2025 (2 PM)
Sprache: Englisch (mit deutscher Zusammenfassung)
Publikation: HTA Projektbericht Nr. 170b: https://eprints.aihta.at/1577/
Hintergrund:
Vorsorgeuntersuchungen (VU) leisten laut dem Dachverband österreichischer Sozialversicherungen einen wesentlichen Beitrag zur gestiegenen Lebenserwartung in Österreich seit 1974 [1]. Im nationalen Kontext zielen die Vorsorgeuntersuchungen auf die Vermeidung gesundheitlicher Risikofaktoren (Primärprävention) sowie die Früherkennung von Krankheiten (Sekundärprävention) ab. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen, die zu den häufigsten Todesursachen in Österreich zählen [2]. Um den Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung nachhaltig zu verbessern, richtet sich das Angebot an alle Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich[1]. Die Durchführung erfolgt vorwiegend durch niedergelassene Ärzt:innen der Allgemeinmedizin sowie Fachärzt:innen der Inneren Medizin [1]. Je nach Alter und Geschlecht werden spezifische Gesundheitsthemen adressiert, darunter die Risikoermittlung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) sowie lebensstilbezogene Beratung und Unterstützung [3]. Ein zweiteiliger Vorsorge-Prozess beinhaltet zunächst die Bestimmung von Risikofaktoren mittels Blutwertbestimmungen, Harnanalyse und körperlichen Untersuchungen und schließlich die Befundbesprechung und (lebensstilbezogene) Beratung.
Teil 1: Reviews zu Lebensstilberatung und Scores zur Prognose von Herz-Kreislauf Erkrankungen
Projektleitung: Jule Anna Pleyer
Projektbearbeitung: Jule A. Pleyer, Lena Grabenhofer, Viktoria Hofer
Qualitätssicherung: Ingrid Zechmeister- Koss
Laufzeit: Mitte April 2025 – Mitte November 2025 (7 PM)
Sprache: Englisch (mit deutscher Zusammenfassung)
Teil 1 des Projekts fokussiert auf zwei zentrale Bereiche der VU – die Lebensstilberatung (LsB) als Maßnahme der Primärprävention sowie Risikobewertungsscores für HKE im Rahmen der Sekundärprävention. Zu beiden Aspekten werden eigenständige Berichte erstellt.
Bericht 7.1.1: Kurzinterventionen in der Lebensstilberatung: Systematische Überprüfung
Erstautorin: Jule Anna Pleyer
Zweitautorin: Lena Grabenhofer
Hintergrund:
Ein ungesunder Lebensstil ist eng mit der Krankheitslast der österreichischen Bevölkerung verbunden, von der zwei Drittel an chronischen Krankheiten und Gesundheitsproblemen leidet [4]. Der österreichische Gesundheitsbericht 2022 zeigt, dass Frauen durchschnittlich 19,5 Jahre und Männer 16,4 Jahre ihres Lebens in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit verbringen. Grund dafür sind insbesondere Probleme mit dem Bewegungsapparat, Diabetes, Asthma, COPD, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Depressionen [4]. Die Entstehung dieser chronischen Erkrankungen ist maßgeblich mit vier Hauptrisikofaktoren assoziiert: Tabakkonsum, unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel und übermäßiger Alkoholkonsum [5].
Mit der Modifizierung der österreichischen Vorsorgeuntersuchung, die im Jahr 2018 durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungen und die Österreichische Ärztekammer erfolgte [6], wurde die Beraterrolle der Ärzt:innen deutlich gestärkt. Diese sollen nun vermehrt die individuelle Lebenssituation der Patient:innen berücksichtigen und spezifische Beratung zu Rauchentwöhnung, Ernährung und körperlicher Aktivität anbieten. Die Lebensstilberatung (LsB) als integraler Bestandteil der österreichischen Vorsorgeuntersuchung könnte dadurch spezifischen Krankheiten vorbeugen und die Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen verbessern und damit präventive als auch gesundheitsfördernde Ziele verfolgen [7].
Der Leitfaden zur Vorsorgeuntersuchung [6]definiert Maßnahmen bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte (z.B. Ernährungsberatung bei erhöhtem BMI) oder empfiehlt bei Alkohol- und Tabakkonsum die strukturierte Intervention der "fünf Es" (Erfragen, Erfassen, Erwirken, Erreichen, Einrichten). Zusätzlich wurde im Rahmen der österreichischen Gesundheitsreform 2016 eine bundesweite Strategie zur Verbesserung der Gesprächsqualität in der Krankenversorgung beschlossen. Darin sind u. a. Kommunikationstools für Angehörige von Gesundheitsberufen enthalten, die Beratungsprozesse unterstützen sollen, da eine gute Gesprächsqualität im Sinne einer patientenzentrierten Gesprächsführung einen positiven Effekt auf das Gesundheitsverhalten von Patient:innen zu haben scheint [8].
Trotz bestehender Vorsorgeuntersuchungsempfehlungen und Kommunikationstools hat sich das Ernährungs- und Bewegungsverhalten in Österreich in den letzten Jahren verschlechtert. Außerdem liegen der Tabakkonsum bei Männern und der Alkoholkonsum im Allgemeinen weiterhin im EU-Durchschnitt, während Frauen in Österreich sogar einen überdurchschnittlichen Tabakkonsum aufweisen. Zudem verfügt jede zweite Person über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz [4]. Diese Entwicklungen werfen die zentrale Frage auf, inwiefern Lebensstilberatungen tatsächlich zur Verbesserung der österreichischen Bevölkerungsgesundheit beitragen können, und wie Praktiker:innen in ihrer Beratungstätigkeit effektiv unterstützt werden können.
Berichtziele:
Das Hauptziel des ersten Berichts ist es, die Evidenz zur Wirksamkeit von Lebensstilberatungen zur körperlichen Aktivität, Ernährung und Alkoholkonsum systematisch zu analysieren und ihren Implementierungsprozess explorativ zu ermitteln, um evidenzbasierte Empfehlungen für eine verbesserte Umsetzung im österreichischen Vorsorgeuntersuchungskontext zu entwickeln.
Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen (FF):
- FF1: Welche evidenzbasierten Kurzinterventionen (z. B. Kommunikationsmodelle, praktische Tools) werden in der Lebensstilberatung für körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und Alkoholkonsum eingesetzt?
- FF2: Wie wirksam sind die identifizierten Interventionen und ihre spezifischen Merkmale (z. B. eine geschulte Intervention) im Vergleich zueinander bei der Verbesserung von Lebensstilsänderung der Empfänger?
- FF2: Was sind die Voraussetzungen und Barrieren für die Umsetzung von lebensstilbezogenen Kurzinterventionen im Rahmen der österreichischen Vorsorgeuntersuchung?
Nicht-Ziel:
In diesem Bericht soll kein Handbuch zur Umsetzung von LsB in der Praxis erstellt werden.
Methoden:
Forschungsfrage 1 und 2:
Zur Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen bezüglich der Identifizierung von lebensstilbezogenen Kurzinterventionen zu körperlicher Aktivität, gesunder Ernährung und Alkoholkonsum sowie zum Vergleich ihrer Wirksamkeit wird eine systematische Literatursuche in mehreren Datenbanken nach Übersichtsarbeiten (und Primärstudien, falls keine Übersichtsarbeiten verfügbar sind) durchgeführt. Relevante Literatur wird auf der Grundlage vordefinierter Ein- und Ausschlusskriterien identifiziert. Bestehende lebensstilbezogene Kurzinterventionen für die Beratung (Instrumente, Kommunikationsformen, psychologische Modelle, Informationsmaterial) werden aus der relevanten Literatur extrahiert, in vorstrukturierten Tabellen zusammengefasst und narrativ synthetisiert. Für die Forschungsfrage 1 (RQ1) wird keine Qualitätsbewertung durchgeführt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2 (RQ2) wird die Qualität der ausgewählten Literatur mit geeigneten Instrumenten (je nach Studiendesign) bewertet.
Alle Schritte zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen (Literaturauswahl, Qualitätsbewertung, Datenextraktion und Synthese) werden von zwei Autoren (JP, LMG und möglicherweise VH) nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt.
Forschungsfrage 3:
Für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage werden qualitative Expert:innen-Interviews durchgeführt. Hierfür werden Praktiker:innen, die bereits Vorsorgeuntersuchungen durchführen mit halb-strukturierter Leitfäden befragt. Im Mittelpunkt der Befragung stehen die aktuellen Herausforderungen und Bedarfe, die den Befragten während der Durchführung der Lebensstilberatung begegnen sowie eine Einschätzung zu förderlichen Aspekten und der Umsetzbarkeit identifizierter Tools und Ansätze in der Praxis. Interviews werden transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
PICO LsB:
|
Population |
Empfänger von lebensstilbezogenen Kurzinterventionen in Beratungssituationen. Schlüsselworte: brief intervention; lifestyle counselling; behaviour change; obesity; nutrition; healthy diet; physical activity; alcohol; check-up; primary care |
|
Intervention |
Kurzinterventionen (Maßnahmen, Programme, Tools, Kommunikationsleitfäden) der Lebensstilberatung zur:
|
|
Kontrolle |
Vergleich von Kurzinterventionen und/oder ihren Parametern untereinander (oder mit der Standardversorgung, wenn keine vergleichenden Studien verfügbar sind) |
|
Outcomes |
Forschungsfrage 1:
Forschungsfrage 2:
Forschungsfrage 3:
|
|
Studiendesign |
Forschungsfrage 1 und 2: Reviews (Primärstudien, wenn keine Reviews verfügbar sind) (Beispielfragen: Was würde die Durchführung in der Praxis erleichtern? Stellen Sie sich vor Sie haben folgende Tools (identifizierte evidenzbasierte Tools aus Literatur) wie können Sie sich die praktische Umsetzung vorstellen?) |
|
Länder |
Westliche Länder mit vergleichbaren Gesundheitssystem |
|
Sprachen |
Forschungsfrage 1 und 2: Englisch, Deutsch Forschungsfrage 3: Deutsch |
Bericht 7.1.2: Scores zu Prognose von Herz-Kreislauf Erkrankungen
Erstautorin: Lena Grabenhofer
Zweitautorin: Jule Anna Pleyer
Hintergrund:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) oder auch Kardiovaskuläre Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten und Todesursachen [9, 10]. Besonders besorgniserregend ist die Prognose für die kommenden Jahre: Während derzeit jährlich etwa 17,3 Millionen Menschen an den Folgen von HKE sterben (Stand 2018), wird trotz kontinuierlicher Fortschritte in der Herzmedizin ein Anstieg auf rund 23,6 Millionen Todesfälle bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Diese Entwicklung betrifft vor allem die westlichen Gesellschaften [11]. In Österreich spiegelt sich diese globale Problematik in konkreten Zahlen wider: Im Jahr 2023 verstarben 31.129 Personen an den Folgen einer HKE, wobei 22.510 dieser Todesfälle Menschen im Alter von 80 Jahren und älter betrafen [12].
Die Entstehung von HKE wird durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren begünstigt. Diese lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen [9]:
- Körperliche Faktoren (z. B. genetische Veranlagung, Hyperglykämie, Übergewicht, Adipositas, Diabetes)
- Verhaltensbezogene Faktoren (z. B. Rauchen, Fehlernährung, Bewegungsmangel)
- Psychische Faktoren (z. B. chronischer Stress, Persönlichkeitsfaktoren)
- Soziale Faktoren (z. B. Bildung, Einkommen, berufliche Position)
HKE verursachen neben einer gewaltigen Krankheitslast auch hohe Kosten für das Gesundheitssystem. Die jährlichen Kosten aufgrund von HKE werden in der EU auf rund 282 Milliarden Euro geschätzt. Davon belaufen sich rund 155 Milliarden Euro (55 %) auf direkte Gesundheitskosten und Langzeitpflege, weitere 48 Milliarden Euro (17%) entstehen durch Produktivitätsverluste. Die restlichen rund 79 Milliarden Euro (28%) sind auf Kosten zurückzuführen, die durch die Zeit und den Aufwand informeller Pflegekräfte entstehen [13].
Durch geeignete Präventionsmaßnahmen können vorzeitige Todesfälle aufgrund von HKE und eine frühe Entstehung von HKE verzögert und entsprechend die gesunde Lebenserwartung verbessert werden. Die Prävention von HKE ist ein vielschichtiges Konzept, das auf mehreren Ebenen ansetzt:
Primärprävention: Vermeidung und Reduktion bekannter Risikofaktoren. Hier steht die Förderung eines gesunden Lebensstils im Vordergrund, bevor es überhaupt zu einer Erkrankung kommt.
Sekundärprävention: frühzeitiges Erkennen von Erkrankungen und Risiken.
Tertiärprävention: Vermeidung des Fortschreitens bereits bestehender Erkrankungen und möglicher Folgeerkrankungen [14].
Vor diesem Hintergrund soll die Bedeutung einer systematischen Risikoerhebung (Sekundärprävention) für HKE untersucht werden. Zu den wichtigsten Untersuchungsparametern gehören neben der Familienanamnese, bestehender Diabetes mellitus und Raucherstatus auch Befunde zu Blutdruck, Gesamt- und HDL-Cholesterin [6]. Moderne Scoring-Modelle wie SCORE-2, PROCAM und Arriba (aus dem Framingham-Risiko-Score entwickelt) ermöglichen eine Vorhersage des individualisierten 10-Jahres-Gesamtrisikos für tödliche und nicht-tödliche kardiovaskuläre Ereignisse [15]. Die European Society of Cardiology [(ESC) dt. Europäische Gesellschaft für Kardiologie] hat beispielsweise im Jahr 2021 in ihren Leitlinien zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine überarbeitete Version der SCORE-Risikobewertung eingeführt, den SCORE2. Für die spezifische Risikoeinschätzung bei Menschen über 70 Jahren wurde zudem der SCORE2-OP (für "older persons", ältere Personen) entwickelt, der den besonderen Risikofaktoren dieser Altersgruppe Rechnung trägt [16].
Berichtziele:
Ziel des zweiten Berichts ist es, die wissenschaftliche Literatur über die Möglichkeiten der Prognose von Herzkreislauf-Erkrankungen systematisch zu erfassen, die am häufigsten beschriebenen und für die westeuropäische Bevölkerung zutreffenden Risikovorhersagemodelle gegenüberzustellen und bezüglich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung zu bewerten. Dabei sollen die Fragen Beachtung finden, welche (zusätzlichen) Voraussetzungen für die Durchführungen der jeweiligen Instrumente erfüllt sein müssen und wie sich die Ergebnisse der Risikoscores auf weitere gesundheitsbezogene Untersuchungen auswirken. Der Fokus hierbei liegt auf der einheitlichen Implementierung der Scoring-Modelle in Österreich.
Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:
- FF1: Wie vergleichen sich kardiovaskuläre Risikoprognosemodelle (z. B. ARRIBA, SCORE2, SCORE2-OP und SCORE2-Diabetes) und wie unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Evidenz, Vorhersagevalidität, der Nutzen-Schaden Bilanz und ihrer Implementierbarkeit im Rahmen österreichischer Vorsorgeuntersuchungen?
- FF2: Inwiefern führt die Anwendung kardiovaskulärer Risikoprognosemodelle zu einem langfristigen gesundheitlichen Nutzen, sowie zu Veränderungen im Gesundheitsverhalten der Patient:innen?
- FF3: Welche Parameter werden bereits standardmäßig in Vorsorgeuntersuchungen erhoben, welche zusätzlichen Untersuchungen sind für eine optimale Implementierung der Risikoscores erforderlich, und welche organisatorischen, zeitlichen und personellen Ressourcen werden hierfür benötigt?
Nicht-Ziele:
Das Projekt hat NICHT zum Ziel:
- Der Bericht soll keine quantitative Folgekostenanalyse zu FF 3 bieten
Methoden:
Für die Beantwortung der Forschungsfragen FF1 bis FF3 erfolgt zunächst eine systematische Literaturrecherche. Die Selektion der relevanten Publikationen basiert auf vorab definierten Ein- und Ausschlusskriterien. Sämtliche methodische Schritte, einschließlich der Literaturauswahl, Datenextraktion und gegebenenfalls der Qualitätsbewertung, werden nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt: Eine Wissenschaftlerin übernimmt die primäre Bearbeitung, während eine zweite Wissenschaftlerin diese Ergebnisse überprüft und validiert. Nach Abschluss der Literaturrecherche werden die identifizierten Outcomes systematisch extrahiert und zusammenfassend analysiert.
Anhand dessen sollen die wichtigsten Instrumente zur kardiovaskulären Risikovorhersage im westeuropäischen Raum, unter anderem SCORE2, SCORE2-OP, SCORE2-Diabetes sowie PROCAM und ARRIBA ermittelt und gegenübergestellt werden. Die Analyse gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauenden Schritte:
Zunächst erfolgt eine umfassende Bestandsaufnahme der existierenden Prognoseinstrumente und ihrer methodischen Grundlagen.
Im zweiten Schritt wird die Evidenzbasis dieser Instrumente kritisch beleuchtet. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die Prognosescores das tatsächliche kardiovaskuläre Risiko präzise vorhersagen können und ob ihre Anwendung nachweislich zu messbaren Gesundheitsverbesserungen führt.
Der dritte Untersuchungsfokus bei der Datenanalyse liegt auf den praktischen Implementierungsaspekten: Welche spezifischen Parameter werden für die verschiedenen Scores benötigt, welche davon werden bereits standardmäßig in Vorsorgeuntersuchungen in Österreich erhoben, und welcher zusätzliche Aufwand entsteht für Patienten und medizinisches Personal.
PICO 2 HKE:
|
Population |
Adressat:innen der kardiovaskulären Risikovorhersage (Patient:innen) Schlüsselworte: Arriba, SCORE2, Procam, kardiovaskuläre Risikovorhersage, Cardiovascular disease, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vorsorgeuntersuchung, ARRIBA-Score, Framingham Risk Score |
|
Intervention |
Risikovorhersagemodelle für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B: SCORE2, PROCAM, Arriba-Score) |
|
Kontrolle |
|
|
Outcomes |
|
|
Publikationsart |
qualitativ hochwertige systematische Reviews oder RCTs/Primärstudien Alle weiteren Outcomes: keine Einschränkung im Studiendesign |
|
Länder |
westeuropäischer Raum, Österreich |
|
Sprachen |
Englisch, Deutsch |
Zeitplan:
|
Zeitfenster |
Tasks |
|
April 2025 |
Scoping und Finalisierung des Projektprotokolls |
|
Mai 2025 |
Systematische Reviews
Primärdatenerhebung
|
|
Juni – Juli 2025 |
Systematische Reviews
Primärdatenerhebung
|
|
August – September 2025 |
Verschriftlichung |
|
Oktober 2025 |
Interner und externer Review |
|
November 2025 |
Layout & Veröffentlichung |
Referenzen:
[1] Langmann H. e. a. Bericht des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger an das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 447h (4) ASVG für das Jahr 2023. 2024.
[2] Gesundheit.gv.at. Die Vorsorgeuntersuchung auf einen Blick. 2025 [updated 27. 04 2021; cited 10.04.2025]. Available from: https://www.gesundheit.gv.at/leben/gesundheitsvorsorge/vorsorgeuntersuchung/was-wird-gemacht.html#ziele-der-vorsorgeuntersuchung
[3] Sozialversicherungen Ö. Vorsorgeuntersuchung. 2020.
[4] Bundesministerium für Soziales G., Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). Österreichischer Gesundheitsbericht 2022. Wien: 2023.
[5] CDC. About Chronic Diseases. 2024 [cited 11.04.2025]. Available from: https://www.cdc.gov/chronic-disease/about/index.html#:~:text=Most%20chronic%20diseases%20are%20caused,ability%20to%20make%20healthy%20choices.
[6] Vorsorgeuntersuchung. 2018 [cited 11.04.2025]. Available from: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.605059&version=1540894684&utm_source=chatgpt.com.
[7] Tiemann M. M., Melvin Prävention und Gesundheitsförderung. Berlin: Springer-Verlag GmbH; 2021.
[8] GmbH G. Ö. ÖPGK?Toolbox Gesundheitskompetenz. Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung. Vienna, Austria: 2023.
[9] Griebler R. W., Petra; Delcour, Jennifer; Eisenmann, Alexander. Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich Update 2020. Wien: 2021 [cited 09.04.2025]. Available from: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ef1ec0fd-01a7-4047-9828-42ce906a2239/Bericht__HKE_2020_2021_Mit_Titelbild.pdf.
[10] Visseren F. L. J., Mach F., Smulders Y. M., Carballo D., Koskinas K. C., Back M., et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484.
[11] Bundesministerium Arbeit S., Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Herz-Kreislauf-Krankheiten. [updated 13.12.2021; cited 09.04.2024]. Available from: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Herz-Kreislauf-Krankheiten.html#:~:text=Herz%2DKreislauf%2DErkrankungen,-Herz%2DKreislauf%2DErkrankungen&text=Weltweit%20sterben%20j%C3%A4hrlich%20rund%2017,Millionen%20im%20Jahr%202030%20prognostizieren.
[12] AUSTRIA S. Häufigste Todesursachen 2023 weiterhin HerzKreislauf-Erkrankungen und Krebs. Pressemitteilung: 13 366-132/24 ed. Wien: Bundesanstalt Statistik Österreich; 2024.
[13] Luengo-Fernandez R., Walli-Attaei M., Gray A., Torbica A., Maggioni A. P., Huculeci R., et al. Economic burden of cardiovascular diseases in the European Union: a population-based cost study. Eur Heart J. 2023;44(45):4752-4767. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad583.
[14] Gesundheit.gv.at. Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Vorbeugung. 2021 [cited 09.04.2025]. Available from: https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/herz-kreislauf/herz-kreislauf-erkrankungen-vorbeugung.html#welche-risikofaktoren-fuer-herz-kreislauf-erkrankungen-gibt-es.
[15] Angelow A., Klötzer C., Donner-Banzhoff N., Haasenritter J., Schmidt C. O., Dörr M., et al. Validation of Cardiovascular Risk Prediction by the Arriba Instrument. Dtsch Arztebl Int. 2022;119(27-28):476-482. DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0220.
[16] group S. w. and collaboration E. S. C. C. r. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J. 2021;42(25):2439-2454. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab309.
Teil 2: Rapid Review zu Screening auf Nierenerkrankungen und Zusammenfassungen zu Prostatakrebs-Screening, Lungenkarzinom-Screening und Screening Bauchaortenaneurysma
Projektleitung: Doris Giess
Projektbearbeitung: Doris Giess, Julia Mayer-Ferbas
Qualitätssicherung: Ingrid Zechmeister- Koss
Laufzeit: Mai 2025 bis August 2025 (2 PM)
Sprache: Englisch mit deutscher Zusammenfassung
Der Fokus dieses Teils sind jene Screening Untersuchungen, die derzeit nicht in der österreichischen Gesundheitsvorsorge integriert sind, nämlich das Screening auf Prostatakarzinom[i], Lungenkarzinom, Bauchaortenaneurysma (BAA) und chronische Nierenerkrankungen (CKD).
Prostatakrebs stellt die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Österreich dar und ist eine der führenden Ursachen für krebsbedingte Todesfälle. Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2022 rund 6.000 neue Fälle von Prostatakrebs diagnostiziert, was einer altersstandardisierten Inzidenz von etwa 110 pro 100.000 Männern entspricht [1]. Das prostataspezifische Antigen (PSA) wird seit den 1990er-Jahren als Screeningmethode eingesetzt, obwohl der Nutzen und mögliche Schaden einer bevölkerungsweiten Anwendung weiterhin kontrovers diskutiert werden.
Im Jahr 2021 wurden laut Statistik Austria etwa 4.600 neue Fälle von Lungenkrebs diagnostiziert, mit einer altersstandardisierten Inzidenz von rund 50 pro 100.000 Personen [3]. Besonders betroffen sind starke Raucherinnen und Raucher sowie ehemalige Raucher:innen. Zur Früherkennung wird in mehreren Ländern das Screening mittels Niedrigdosis-CT (LDCT) empfohlen oder bereits umgesetzt, da es in großen randomisierten Studien zu einer signifikanten Reduktion der lungenkrebsbedingten Mortalität geführt hat [2-4].
Das BAA stellt eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung dar, bei der es zu einer Erweiterung der Bauchschlagader kommt. Aktuelle Daten zur Prävalenz von BAA in Österreich sind begrenzt. Eine rezente globale systematische Übersichtsarbeit berichtet, dass bei über 65-jährigen Männern die Prävalenz von BAA mit einem Durchmesser ? 3,0 cm bei 3.5% bis 6.5 % vorliegt. Frauen sind weniger häufig betroffen mit einer Prävalenz von 0.8% bis 1.4% [5]. Die Gesamtmortalität für Patient:innen mit rupturiertem BAA liegt bei etwa 75%, auch bei chirurgischer Intervention. Unbehandelt führt eine Ruptur in der Regel innerhalb von Stunden zum Tod [6]. Die Früherkennung mittels Ultraschalluntersuchung hat sich als wirksam erwiesen, um das Risiko einer Ruptur zu verringern und die Überlebensrate zu erhöhen [7].
CKD stellen weltweit ein wachsendes Gesundheitsproblem dar. In Österreich sind etwa 8–10% der Erwachsenen von einer CKD betroffen, wobei die Dunkelziffer aufgrund asymptomatischer Verläufe vermutlich höher liegt. Besonders gefährdet sind Personen mit Risikofaktoren wie Diabetes mellitus und Bluthochdruck. Frühe Diagnosen und Interventionen können das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen und die Entwicklung von Komplikationen wie Nierenversagen verhindern. Laut dem österreichischen Nierenbericht werden trotz internationaler Empfehlungen, Risikopatient:innen regelmäßig auf das Vorliegen einer CKD zu untersuchen, in Österreich jährlich nur bei etwa 17 % der Betroffenen entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Aktuell ist das CKD-Screening der Allgemeinbevölkerung Gegenstand laufender Forschungsprojekte und wird in den meisten Ländern noch nicht umgesetzt [8].
Projektziele:
Ziel dieses Berichtes ist es, die Evidenzlage zu den jeweiligen Screeningstrategien anhand rezenter HTA-Berichte und systematischer Übersichtsarbeiten zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf ihren Nutzen für die jeweils relevante Zielpopulation. Zusätzlich werden die aktuellen S3-Leitlinienempfehlungen zusammengefasst, um eine evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage für den österreichischen Vorsorgeuntersuchungskontext zu schaffen.
Forschungsfrage 1:
Wie wurde in rezenten HTA-Berichten der Nutzen des PSA-basierten Screenings auf Prostatakarzinom im Hinblick auf patient:innennrelevante Endpunkte bewertet, und welche Empfehlungen sprechen aktuelle Leitlinien diesbezüglich aus?
Forschungsfrage 2:
Wie wurde in rezenten HTA-Berichten der Nutzen des Screenings auf Lungenkrebs mittels LDCT hinsichtlich patient:innenrelevanter Endpunkte bewertet und welche Empfehlungen sprechen aktuelle Leitlinien diesbezüglich aus?
Forschungsfrage 3:
Wie wurde in rezenten HTA-Berichten der Nutzen eines Screenings auf BAA mittels Ultraschalluntersuchung hinsichtlich patient:innenrelevanter Endpunkte bewertet und welche Empfehlungen sprechen aktuelle Leitlinien diesbezüglich aus?
Forschungsfrage 4:
- Wie wurde in rezenten systematischen Übersichtsarbeiten der Nutzen eines Screenings auf CKD hinsichtlich patient:innenrelevanter Endpunkte bewertet?
- Für welche Zielpopulationen wurde in den Übersichtsarbeiten ein Screening auf CKD als nützlich befunden?
- Welche Empfehlungen sprechen aktuelle Leitlinien dazu aus?
Nicht-Ziel:
Dieser Bericht soll keine detaillierte systematische Übersichtsarbeit von Primärstudien sein. Vielmehr steht eine strukturierte Evidenzsynthese bestehender Bewertungsergebnisse im Vordergrund. Wir bewerten auch keine Studien zur diagnostischen Genauigkeit oder Kosten-Effizienzstudien; unser Fokus liegt auf patient:innenrelevanten Endpunkten wie Gesamtmortalität und Morbidität.
Methoden:
Forschungsfrage 1-3:
- Handsuche nach rezenten Leitlinien, Suche nach HTA-Berichten in INAHTA Datenbank und Websites von HTA-Institutionen,
- Erstellung eines visuellen Abstrakts pro Thema, in welchem die wesentlichen Elemente der jeweiligen HTA-Berichte und Leitlinien anschaulich dargestellt werden: Beschreibung der Screeningstrategie und Zielpopulation, Nutzenbewertung anhand von patient:innenrelevanten Endpunkten, eventuell Beschreibung der Kosten-Effektivität, Darstellung von Vor- und Nachteilen (z.B. falsch positive/negative Ergebnisse, Überdiagnose).
Forschungsfrage 4a/b:
Rapid Review von systematischen Übersichtsarbeiten zu Screening auf chronische Niereninsuffizienz
PICOs:
|
Population |
Erwachsene Patient:innen > 18 Jahre ohne diagnostizierte CKD |
|
Intervention |
Screening auf CKD, basierend auf eGFR(SCr), eGFR(cystC) und Proteinurie/Albuminurie/ACR Bestimmung (mit POCT dipstick oder Harnanalyse |
|
Kontrolle |
Kein Screening/Standard of care |
|
Endpunkte |
Nicht: Kosten-Effektivität, diagnostische Genauigkeit |
|
Studiendesigns |
FFa/b: qualitativ hochwertige systematische Übersichtsarbeiten FFc: Handsuche nach rezenten Leitlinien, Suche nach HTA-Berichten in INAHTA Datenbank und Websites von HTA-Institutionen |
|
Geographischer Raum |
Westliche Länder mit etabliertem Gesundheitssystem (u.A. Europa, USA, UK, Australien) |
|
Sprache |
Deutsch, Englisch |
Referenzen:
[1] Statistik Austria. (2023). Krebserkrankungen. Zugriff am 24. April 2025, von Krebserkrankungen - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager
[2] Field, J. K., deKoning, H., Oudkerk, M., Anwar, S., Mulshine, J., Pastorino, U., Eberhardt, W., & Prosch, H. (2019). Implementation of lung cancer screening in Europe: challenges and potential solutions: summary of a multidisciplinary roundtable discussion.?ESMO open,?4(5), e000577. https://doi.org/10.1136/esmoopen-2019-000577
[3] Jonas, D. E., Reuland, D. S., Reddy, S. M., Nagle, M., Clark, S. D., Weber, R. P., ... & Harris, R. P. (2021). Screening for lung cancer with low-dose computed tomography: Updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. JAMA, 325(10), 971–987. https://doi.org/10.1001/jama.2021.1117
[4] Oudkerk, M., Liu, S., Heuvelmans, M. A., Walter, J. E., & Field, J. K. (2021). Lung cancer LDCT screening and mortality reduction - evidence, pitfalls and future perspectives.?Nature reviews. Clinical oncology,?18(3), 135–151. https://doi.org/10.1038/s41571-020-00432-6
[5] Song P, He Y, Adeloye D, Zhu Y, Ye X, Yi Q, Rahimi K, Rudan I; Global Health Epidemiology Research Group (GHERG). The Global and Regional Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysms: A Systematic Review and Modeling Analysis. Ann Surg. 2023 Jun 1;277(6):912-919. doi: 10.1097/SLA.0000000000005716. Epub 2022 Sep 30. PMID: 36177847; PMCID: PMC10174099. The Global and Regional Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysms: A Systematic Review and Modeling Analysis - PMC
[6] WGKK. (2021). Bauchaortenaneurysma Screening – Aktionswoche 2021. Zugriff am 24. April 2025, von https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20191025_OTS0031
[7] Jeanmonod D, Yelamanchili VS, Jeanmonod R. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture. [Updated 2023 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.?Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459176/
[8] Ali, M. U., Fitzpatrick-Lewis, D., Kenny, M., Miller, J., Raina, P., & Sherifali, D. (2018). A systematic review of short-term vs long-term effectiveness of one-time abdominal aortic aneurysm screening in men with ultrasound. Journal of Vascular Surgery. https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(18)30891-7/fulltext Österreichische Gesellschaft für Nephrologie. (2023). Chronische Nierenerkrankungen in Österreich. Abgerufen am 24. April 2025, von https://www.oegn.at