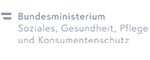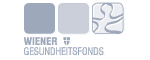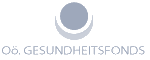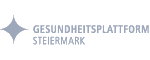Systematische Übersichtsarbeit zur Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit der Enzymersatztherapie bei Mukopolysaccharidose-Erkrankungen und Morbus Pompe

Projektleitung: Sabine Geiger-Gritsch
Projektbearbeitung: Eva Malikova, Sabine Geiger-Gritsch
Ana Pantovic (Erstautor)
Laufzeit: April – September 2025 (5 PM)
Sprache: Englisch mit deutscher Zusammenfassung
Hintergrund:
Zu den lysosomalen Speicherkrankheiten (LSD) gehören seltene erbliche Stoffwechselstörungen, bei denen die Funktion bestimmter Enzyme in den Lysosomen gestört ist. Diese Störungen können in vier Gruppen eingeteilt werden, von denen zwei als Glykogenspeicherkrankheiten (GSD) und Mukopolysaccharidosen (MPS) bekannt sind.
Die Pompe-Krankheit (Morbus Pompe) gehört zur GSD-Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten und ist als Glykogenspeicherkrankheit Typ 2 bekannt. Es handelt sich um eine seltene, vererbte, fortschreitende Muskelerkrankung, die die Beweglichkeit und die Atmung beeinträchtigt. Sie wird durch einen Mangel des Enzyms Säure-Alfa-Glucosidase (GAA) verursacht, was zu einer lysosomalen Glykogenansammlung und Muskelschäden führt, einschließlich des Zwerchfells und der Skelettmuskeln. Die Inzidenzraten variieren, wobei eine österreichische Studie eine kombinierte Inzidenz für Früh- und Spätformen von 1 zu 8.686 schätzt [4], während eine neuere Studie die Prävalenz auf 1 zu 350.914 schätzt [5]. Es gibt zwei Arten des Morbus Pompe. Morbus Pompe im Kindesalter (Infantile Pompe Disease, IOPD) weist eine geringe bis gar keine GAA-Aktivität auf und tritt typischerweise im frühen Säuglingsalter mit Kardiomyopathie und Hypotonie auf, was unbehandelt häufig innerhalb des ersten Jahres zu einem tödlichen kardiorespiratorischen Versagen führt [6]. Im Gegensatz dazu bleibt bei der spät auftretenden Pompe-Krankheit (LOPD) eine gewisse Enzymaktivität erhalten, was zu einem milderen, aber fortschreitenden Verlauf mit Muskelschwäche und Atemproblemen im späteren Leben führt.
MPS sind eine Gruppe seltener vererbter lysosomaler Speicherkrankheiten, die durch eine eingeschränkte oder vollständige Störung im Abbau komplexer Zucker, so genannter Glykosaminoglykane, gekennzeichnet sind. Es gibt verschiedene Arten von MPS, die anhand des spezifischen Enzymmangels und der daraus resultierenden klinischen Symptome klassifiziert werden. Das Projekt konzentriert sich auf die folgenden drei Arten von MPS-Erkrankungen:
- Mukopolysaccharidose Typ I (MPS I) entsteht durch einen Mangel am Enzym alfa-L-Iduronidase, das die Lysosomen daran hindert, Dermatansulfat und Heparansulfat abzubauen. Es gibt drei Untertypen von MPS I:
o Hurler-Syndrom: Die schwerste Form geht im ersten Lebensjahr mit verschiedenen Symptomen wie Kardiomyopathie, wiederkehrenden Hals-Nasen-Ohren-Problemen und groben Gesichtszügen einher, später entwickeln sich Kleinwuchs, Knochendeformitäten, Entwicklungsverzögerung, Hepatosplenomegalie und Hornhauttrübung. Unbehandelt führt es bis zum Jugendalter zum Tod.
- Hurler-Scheie-Syndrom: Mittlerer Schweregrad.
- Scheie-Syndrom: Die Kinder sind intellektuell normal, können aber durch degenerative Knochenerkrankungen, Hornhauttrübungen und Herzklappenerkrankungen behindert sein.
Die geschätzte Prävalenz liegt bei 1 zu 100.000, wobei das Hurler-Syndrom 57 % der Fälle ausmacht, das Hurler-Scheie-Syndrom 23 % und das Scheie-Syndrom 20 % [1].
- Mukopolysaccharidose Typ II (MPS II, Hunter-Syndrom) ist eine seltene X-chromosomale Erkrankung, die durch einen Mangel des Enzyms Iduronat-2-Sulfatase (I2S) verursacht wird. Neben der neurologischen Beteiligung ist eine der größten Herausforderungen bei MPS II die erhebliche Auswirkung der fortschreitenden körperlichen Anomalien auf die Lebensqualität. Knochenerkrankungen, eingeschränkte Atemfunktion und kardiale Beeinträchtigungen führen zu einer chronisch geringen Ausdauer. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verlieren viele die Fähigkeit, auch nur kurze Strecken zu gehen und sind schließlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Im zweiten Lebensjahrzehnt kommt es bei den meisten Menschen mit einer Beteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS) zu einem schweren kognitiven Verfall und sie sind vollständig auf Pflegekräfte angewiesen [2]. Die Inzidenz von MPS II reicht von 0,38 pro 100.000 Lebendgeburten in Brasilien bis 1,09 pro 100.000 in Portugal. Im Allgemeinen berichten europäische Länder über niedrigere Inzidenzraten im Vergleich zu ostasiatischen Ländern, wo MPS II bis zu 50 % aller MPS-Fälle ausmachen kann [3].
- Mukopolysaccharidose IVA (MPS IVA, Morquio-A-Syndrom oder Morquio-Brailsford-Syndrom) ist eine lysosomale Speicherkrankheit, die autosomal-rezessiv vererbt wird. Sie beruht auf einem Mangel des Enzyms N-Acetylgalactosamin-6-Sulfatase, der zu einer Anhäufung der Glykosaminoglykane Keratansulfat und Chondroitin-6-Sulfat in verschiedenen Geweben, Knochen und Organen führt [7]. Die geschätzte Prävalenz von MPS IVA variiert: 1 von 323.000 in Dänemark, 1 von 599.000 in Großbritannien, 1 von 926.000 in Australien und 1 von 1.872.000 in Malaysia. Die Geburtsprävalenz reicht von 1 zu 71.000 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis zu 1 zu 500.000 in Japan [8,9]. Zu den klinischen Merkmalen gehören Watschelgang, Skelettanomalien, Genu valgum (X-Beine), glockenförmiger Brustkorb, Gelenkhypermobilität, Wirbelsäulendeformitäten, vergrößerte Ellbogen und Handgelenke, Kleinwuchs und ein kurzer Hals. Weitere mögliche Symptome sind leichte Hepatosplenomegalie, Schwerhörigkeit, Atemprobleme, Herzanomalien, Hornhauttrübungen und Zahnschmelzhypoplasie. Im Gegensatz zu anderen MPS-Formen ist bei Morquio A das Gehirn in der Regel nicht betroffen und es kommt auch nicht zu erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen [10].
Derzeit ist die Enzymersatztherapie (ERT) die Standardbehandlung bei Morbus Pompe und MPS-Erkrankungen. Die ERT ist ein systemischer Ansatz, bei dem rekombinante Enzyme intravenös verabreicht werden, um das fehlende Enzym bei den betroffenen Personen zu ersetzen. Durch die gezielte Behebung des zugrunde liegenden Enzymmangels soll die ERT die Symptome lindern, das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und die Lebensqualität der Patient:innen mit LSD verbessern. Die Diagnose und Einleitung der ERT wird in Österreich in der Regel in spezialisierten Zentren in Krankenhäusern durchgeführt. Da die Patient:innen lebenslange monatliche Infusionen benötigen, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patient:innen und ihrer Betreuer:innen. In einigen Ländern, so auch in Österreich, können bestimmte Patient:innen ihre Infusionen nicht in der Klinik, sondern zu Hause erhalten. Die Heiminfusion von ERT ist für mehrere LSD zugelassen, was sich positiv auf die Lebensqualität sowohl der Patient:innen als auch ihrer Betreuer:innen auswirkt.
Im Allgemeinen konnte mittels ERT eine Verringerung der Organvergrößerung, die Verbesserung des Blutbildes, die Linderung von Skelett- und neurokognitiven Symptomen und die Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden. Trotz ihrer Wirksamkeit hat die ERT aber auch ihre Grenzen: Sie kann Gewebeschäden, die bereits vor Beginn der Behandlung aufgetreten sind, möglicherweise nicht mehr rückgängig machen, erfordert eine lebenslange Verabreichung, kann zu Antikörpern gegen das Medikament führen, und durch die Notwendigkeit regelmäßiger Infusionen für Patient:innen und Pflegepersonal eine logistische Herausforderung darstellen [12]. Außerdem kann die ERT die Blut-Hirn-Schranke (BHS) nur begrenzt überwinden, so dass sie das ZNS nicht erreichen kann. Darüber hinaus ist das derzeitige Wissen über die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit dieser Behandlungen im Versorgungsalltag begrenzt, was den Bedarf an einer systematischen Evaluierung unterstreicht. Das vorliegende Projekt fokussiert sich auf Evidenz zur Langzeitdaten aus dem Versorgungsalltag zu den folgenden ausgewählten Therapien (ERT) für vier verschiedene LSD:
- Avalglucosidase alfa und Alglucosidase alfa für Morbus Pompe
- Laronidase für Mukopolysaccharidose Typ I (MPS I)
- Idursulfase für das Hunter-Syndrom (MPS II)
- Elosulfase alfa für Mukopolysaccharidose Typ IVA (MPS IVA; Morquio-A-Syndrom)
Ziele des Projekts:
Ziel dieses Projekts ist es, eine systematische Suche und eine qualitative Evidenzsynthese veröffentlichter Studien durchzuführen, in denen die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit der fünf ERTs (Laronidase, Idursulfase, Alglucosidase alfa, Avalglucosidase alfa, Elosulfase alfa) bei der Behandlung der Pompe-Krankheit und dreier Arten von MPS-Erkrankungen (MPS I, MPS II und MPS IVA) untersucht wurden.
Nicht-Zielsetzungen:
Diese Ziele liegen nicht im Rahmen dieses Projekts:
- Bewertung der kurzfristigen Wirksamkeit und Sicherheit (weniger als 2 Jahre Follow-up)
- Bewertung anderer ERT als der fünf ausgewählten Behandlungen
Forschungsfragen (FF):
- FF1: Wie ist die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit von Alglucosidase alfa und Avalglucosidase alfa bei der Behandlung der Pompe-Krankheit?
- FF2: Wie ist die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit von Laronidase bei der Behandlung von MPS I?
- FF3: Wie ist die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit von Idursulfase bei der Behandlung des Hunter-Syndroms (MPS II)?
- FF4: Wie ist die Langzeit-Wirksamkeit und -Sicherheit von Elosulfase alfa bei der Behandlung von MPS IVA?
Methoden:
Es wurde eine vorläufige Suche durchgeführt, um rezente systematischen Übersichtsarbeiten (SR) zu identifizieren, die der Fragestellung der vorliegenden Evaluierung entsprechen. Die identifizierten systematischen Übersichtsarbeiten (SR) werden auf der Grundlage ihres Umfangs, der Ein- und Ausschlusskriterien und der methodischen Qualität mit Hilfe des Risk of Bias Assessment Tool for Systematic Reviews (ROBIS) bewertet. Qualitativ hochwertige SR, die der Fragestellung entsprechen, werden mittels Literatursuche aktualisiert. Wird keine qualitativ hochwertige Übersichtsarbeit gefunden oder ist diese nicht verfügbar, wird eine systematische Literatursuche nach Primärstudien in verschiedenen Datenbanken sowie eine manuelle Suche in den Referenzen der relevanten veröffentlichten SR und weiteren Zeitschriftenartikel durchgeführt. Zusätzlich wird manuell nach Registern und nach Publikationen aus diesen Registern gesucht. Das Screening der Abstracts und Volltexte wird von zwei Autor:innen unabhängig voneinander durchgeführt. Im Falle von Uneinigkeit wird ein:e dritte:r Autor:in kontaktiert. Bei der Auswahl der Studien wird ein hierarchischer Ansatz verfolgt, bei dem randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), nicht-randomisierte kontrollierte Studien (NRCTs) und Beobachtungsstudien mit einem prospektiven Design bevorzugt werden.
Die Daten werden in einer vordefinierten tabellarischen Form extrahiert, die folgende Informationen enthält: Einzelheiten über das Studiendesign, die Intervention (Dosierung, Dauer), den Komparator (falls zutreffend), die Dauer der Nachbeobachtung, Einzelheiten über die Patientenpopulation (Alter, Geschlecht, Schwere der Krankheit, Krankheitsmanifestation/Symptome/Zustände) und die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf patient:innenrelevante Endpunkte. Das Risiko einer Verzerrung (RoB) der eingeschlossenen Studien wird mit dem Cochrane Risk of Bias 2.0 Tool für randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) und mit dem Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Interventions (ROBINS-I) für nicht-randomisierte Studien (NRSs) bewertet. Die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz wird anhand des GRADE-Ansatzes bewertet [13].
PICO - Einschlusskriterien für relevante Literatur:
Alglucosidase alfa und Avalglucosidase alfa bei Morbus Pompe im Kindesalter (IOPD)
|
Population |
Patient:innen aller Altersgruppen mit infantiler Pompe-Krankheit (frühe Verlaufsform) Alternative Begriffe: Typ-II-Glykogenose, Glykogenspeicherkrankheit Typ II, saure Maltase-Mangelkrankheit, Mangel an saurer alfa-Glukosidase, infantile Pompe-Krankheit, IOPD |
|
Intervention |
Alglucosidase alfa Avalglucosidase alfa Alternativer Begriff: Enzymersatztherapie (ERT) |
|
Kontrollgruppe |
jegliche Art von Kontrollintervention |
|
Endpunkte |
|
|
Wirksamkeit |
|
|
Sicherheit |
|
|
Publikationstyp |
Die minimale Stichprobengröße beträgt 5 Patient:innen. Falls eine ausreichende Anzahl an Studien verfügbar ist, werden nur Studien mit größerer Stichprobengröße (n > 10) eingeschlossen. Ausgeschlossen: In-vitro-Studien, Tierversuche, Fallberichte, Konferenzabstracts, Editorials |
Abkürzungen: ECG = Elektrokardiogramm, LV = Linker Ventrikel, ERT = Enzymersatztherapie, IOPD = Infantile Pompe-Krankheit (frühe Verlausform), n = Anzahl der Patient:innen, NRCs = Nicht-randomisierte kontrollierte Studien, RCTs = Randomisierte kontrollierte Studien
Alglucosidase alfa und Avalglucosidase alfa bei Morbus Pompe im Spätstadium (LOPD)
|
Population |
Patient:innen aller Altersgruppen mit late-onset Pompe-Krankheit (späte Verlaufsform) Alternative Begriffe: Typ-II-Glykogenose, Glykogenspeicherkrankheit Typ II, saure Maltase-Mangelkrankheit, Mangel an saurer alfa-Glukosidase, late-onset Pompe-Krankheit, LOPD |
|
Intervention |
Alglucosidase alfa Avalglucosidase alfa Alternativer Begriff: Enzymersatztherapie (ERT) |
|
Kontrollgruppe |
jegliche Art von Kontrollintervention |
|
Endpunkte |
|
|
Wirksamkeit |
|
|
Sicherheit |
|
|
Publikationstyp |
Die minimale Stichprobengröße beträgt 5 Patient:innen. Falls eine ausreichende Anzahl an Studien verfügbar ist, werden nur Studien mit größerer Stichprobengröße (n > 10) eingeschlossen. Ausgeschlossen: In-vitro-Studien, Tierversuche, Fallberichte, Konferenzabstracts, Editorials |
Abkürzungen: 6MWT = Sechs-Minuten-Gehtest, ERT = Enzymersatztherapi, FEV1 = Forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, FVC = Forcierte Vitalkapazität, LOPD = late-onset Pompe-Krankheit, n = Anzahl der Patient:innen
Laronidase bei Mucopolysaccharidose Type I (MPS I)
|
Population |
Patient:innen aller Altersgruppen mit Mukopolysaccharidose Typ I, einschließlich aller drei Krankheitsformen (Hurler-, Hurler-Scheie- und Scheie-Syndrom). Alternative Begriffe: Mukopolysaccharidose I oder MPS I oder Alfa-L-Iduronidase-Mangel |
|
Intervention |
Laronidase Alternativer Begriff: Enzymersatztherapie (ERT) |
|
Kontrollgruppe |
jegliche Art von Kontrollintervention |
|
Endpunkte |
|
|
Wirksamkeit |
|
|
Sicherheit |
|
|
Publikationstyp |
Die minimale Stichprobengröße beträgt 5 Patient:innen. Falls eine ausreichende Anzahl an Studien verfügbar ist, werden nur Studien mit größerer Stichprobengröße (n > 10) eingeschlossen. Ausgeschlossen: In-vitro-Studien, Tierversuche, Fallberichte, Konferenzabstracts, Editorials |
Abkürzungen: 6MWT = Sechs-Minuten-Gehtest, ERT = Enzymersatztherapie, FEV1 = Forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, FVC = Forcierte Vitalkapazität, EKG = Elektrokardiogramm, GAG = Glykosaminoglykan, MPS I = Mukopolysaccharidose Typ I, n = Anzahl der Patient:innen, NRCs = Nicht-randomisierte kontrollierte Studien, RCTs = Randomisierte kontrollierte Studien
Idursulfase bei Hunter Syndrome (Mucopolysaccharidose Type II)
|
Population |
Patient:innen aller Altersgruppen mit Hunter-Syndrom (Mukopolysaccharidose Typ II) Alternative Begriffe: Mukopolysaccharidose II oder MPS II |
|
Intervention |
Idursulfase Alternativer Begriff: Enzymersatztherapie (ERT) |
|
Kontrollgruppe |
jegliche Art von Kontrollintervention |
|
Endpunkte |
|
|
Wirksamkeit |
|
|
Sicherheit |
|
|
Publikationstyp |
Die minimale Stichprobengröße beträgt 5 Patient:innen. Falls eine ausreichende Anzahl an Studien verfügbar ist, werden nur Studien mit größerer Stichprobengröße (n > 10) eingeschlossen. Ausgeschlossen: In-vitro-Studien, Tierversuche, Fallberichte, Konferenzabstracts, Editorials. |
Abkürzungen: 6MWT = Sechs-Minuten-Gehtest, ERT = Enzymersatztherapie, FEV1 = Forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, FVC = Forcierte Vitalkapazität, EKG = Elektrokardiogramm, GAG = Glykosaminoglykan, MPS II = Mukopolysaccharidose Typ II, n = Anzahl der Patient:innen, NRCs = Nicht-randomisierte kontrollierte Studien, RCTs = Randomisierte kontrollierte Studien
Elosulfase alfa bei Mucopolysaccharidose Typ IVA (MPS IVA; Morquio A Syndrome):
|
Population |
Patient:innen aller Altersgruppen mit Mukopolysaccharidose Typ IVA Alternative Begriffe: Mukopolysaccharidose Typ IVA oder MPS IVA oder Morquio-A-Syndrom oder Morquio-Brailsford-Syndrom |
|
Intervention |
Elosulfase alfa Alternativer Begriff: Enzymersatztherapie (ERT) |
|
Kontrollgruppe |
jegliche Art von Kontrollintervention |
|
Endpunkte |
|
|
Wirksamkeit |
|
|
Sicherheit |
|
|
Publikationstyp |
Die minimale Stichprobengröße beträgt 5 Patient:innen. Falls eine ausreichende Anzahl an Studien verfügbar ist, werden nur Studien mit größerer Stichprobengröße (n > 10) eingeschlossen. Ausgeschlossen: In-vitro-Studien, Tierversuche, Fallberichte, Konferenzabstracts, Editorials. |
Abkürzungen: ERT = Enzymersatztherapie, FEV1 = Forciertes exspiratorisches Volumen in einer Sekunde, FVC = Forcierte Vitalkapazität, 3MSCT = Drei-Minuten-Treppensteigtest, 6MWT = Sechs-Minuten-Gehtest, MPS IVA = Mukopolysaccharidose Typ IVA, n = Anzahl der Patient:innen, NRCs = Nicht-randomisierte kontrollierte Studien, RCTs = Randomisierte kontrollierte Studien
Qualitätssicherung:
Im Rahmen der Qualitätssicherung ist für den gesamten Projektprozess eine Begleitung durch externe klinische Expert:innen vorgesehen. Zusätzlich wird der Bericht vor Fertigstellung einem AIHTA-internen Review als auch einer externen Begutachtung durch einen/eine klinische(n) Expert:in unterzogen.
Zeitplan/Meilensteine (in Monaten):
|
Zeitraum |
Aufgabe |
|
April 2025 |
Scoping, Festlegung der PICO Fragestellung |
|
Mai 2025 |
Literatursuche, Abstract Screening, Studienauswahl, Expert:innenmeeting |
|
Mai, Juni 2025 |
Datenextraktion, Risk of bias Assessment |
|
Juni 2025 |
Evidenzsynthese, Expert:innenmeeting |
|
Juli 2025 |
Berichterstellung |
|
August und September 2025 |
Interner und externer Review, Finalisierung Bericht, Publikation |
Referenzen:
[1] Orphanet. Mucopolysaccharidosis type I. [cited 16.04.2025]. Available from: https://www.orpha.net/en/disease/detail/579?name=MPS1&mode=name
[2] Wraith JE, Scarpa M, Beck M, Bodamer OA, De Meirleir L, Guffon N, et al. Mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome): a clinical review and recommendations for treatment in the era of enzyme replacement therapy. Eur J Pediatr. 2008;167(3):267–277. DOI: 10.1007/s00431-007-0635-4.
[3] Khan SA, Peracha H, Ballhausen D, Wiesbauer A, Rohrbach M, Gautschi M, et al. Epidemiology of mucopolysaccharidoses. Mol Genet Metab. 2017;121(3):227–240. DOI: 10.1016/j.ymgme.2017.05.016.
[4] Mechtler TP, Stary S, Metz TF, De Jesús VR, Greber-Platzer S, Pollak A, et al. Neonatal screening for lysosomal storage disorders: feasibility and incidence from a nationwide study in Austria. Lancet. 2012;379(9813):335–341. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61266-X.
[5] Löscher WN, Huemer M, Stulnig TM, Simschitz P, Iglseder S, Eggers C, et al. Pompe disease in Austria: clinical, genetic and epidemiological aspects. J Neurol. 2018;265(1):159–164. DOI: 10.1007/s00415-017-8686-6.
[6] Kishnani PS, Hwu WL, Mandel H, Nicolino M, Yong F, Corzo D; Infantile-Onset Pompe Disease Natural History Study Group. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr. 2006;148(5):671–676. DOI: 10.1016/j.jpeds.2005.11.033.
[7] Masuno M, Tomatsu S, Nakashima Y, Hori T, Fukuda S, Masue M, et al. Mucopolysaccharidosis IV A: assignment of the human N-acetylgalactosamine-6-sulfate sulfatase (GALNS) gene to chromosome 16q24. Genomics. 1993;16(3):777–778. DOI: 10.1006/geno.1993.1266.
[8] Leadley RM, Lang S, Misso K, Bekkering T, Ross J, Akiyama T, et al. A systematic review of the prevalence of Morquio A syndrome: challenges for study reporting in rare diseases. Orphanet J Rare Dis. 2014;9:173. DOI: 10.1186/s13023-014-0173-x.
[9] Lin HY, Lin SP, Chuang CK, Niu DM, Chen MR, Tsai FJ, et al. Incidence of the mucopolysaccharidoses in Taiwan, 1984–2004. Am J Med Genet A. 2009;149A(5):960–964. DOI: 10.1002/ajmg.a.32781.
[10] Davison JE, Kearney S, Horton J, Foster K, Peet AC, Hendriksz CJ. Intellectual and neurological functioning in Morquio syndrome (MPS IVa). J Inherit Metab Dis. 2013;36(2):323–328. DOI: 10.1007/s10545-011-9430-5.
[11] Hendriksz CJ, Berger KI, Giugliani R, Harmatz P, Kampmann C, Mackenzie WG, et al. International guidelines for the management and treatment of Morquio A syndrome. Am J Med Genet A. 2015;167A(1):11–25. DOI: 10.1002/ajmg.a.36833.
[12] Abelleyra Lastoria DA, Keynes S, Hughes D. Current and emerging therapies for lysosomal storage disorders. Drugs. 2025;85(2):171–192. DOI: 10.1007/s40265-025-02145-5.
[13] Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction—GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):383–394. Epub 2011/01/05. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.04.026